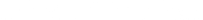Unter den Langzeitarbeitslosen sind Menschen über 50 auffallend stark vertreten …
Nicht zuletzt durch die De-facto-Abschaffung der Invaliditätspension sind mehr Ältere auf Jobsuche. Diese Menschen können nach Jahrzehnten den erlernten Beruf nicht mehr ausüben, haben gesundheitliche Probleme und sind schwer für eine andere Ausbildung zu motivieren. Noch dazu wurden sie bisher von Organisationen betreut, deren Angebot für diese Zielgruppe gar nicht gedacht war – immerhin sind für diese Gruppe jetzt Maßnahmen geplant. Es ist durchaus sinnvoll, wenn hier der öffentliche Sektor einspringt: Der zweite Arbeitsmarkt ist eine gute Möglichkeit, sogenannte arbeitsmarktferne Personen wieder sanft an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Denn was wäre die Alternative? Die Menschen finden doch sonst keine Arbeit oder nur prekäre, vorübergehende Beschäftigung. Und dann werden sie noch kränker, gestresster oder depressiver.
Entsteht eine Spirale nach unten, wenn jemand mehrmals arbeitslos wird – auch, weil in letzter Zeit die Zumutbarkeitsbestimmungen bei der Jobsuche gelockert wurden?
Ich sehe eher eine Auseinanderentwicklung: hier die Hochqualifizierten, deren Jobs nach wie vor sehr sicher sind, und dort der Niedriglohnsektor. Wobei ich glaube, dass Österreich an sich einen klügeren Weg gegangen ist als etwa Deutschland, wo der Niedriglohnsektor in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet worden ist.
Deutlich mehr Frauen als Männer sind armutsgefährdet …
Österreich ist hier eher konservativ, das Modell des männlichen Ernährers hat sich erst in den vergangenen 20 Jahren verändert. Für Frauen ist der Sozialstaat besonders wichtig, weil er sie von Betreuungsaufgaben entlasten kann. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings, dass sich junge Frauen wieder stärker mit traditionellen Gender-Rollen anfreunden. Hochwertige Kinderbetreuung, die theoretisch mehr Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, wird zudem meist von den gut ausgebildeten und besser verdienenden Frauen genützt. Das zweite verpflichtende Kindergartenjahr sehe ich als wertvollen Beitrag, um auch Kindern in bildungsfernen Haushalten von Anfang an eine gute Ausbildung und damit mehr Chancen zu ermöglichen. Beim Thema Frauen fällt mir aber auch ein, dass es – nicht zuletzt angesichts der demografischen Entwicklungen – viel zu wenige Langzeit-Pflegeplätze gibt. Es ist ja einerseits zu begrüßen, dass der Trend dazu geht, dass alte Menschen möglichst lange zu Hause leben. Aber bei vielen besteht irgendwann Pflegebedarf und hier sollte es mehr flexible Angebote geben, damit diese Aufgaben nicht letzten Endes wieder den weiblichen Familienmitgliedern zufallen. Aus meinem Bekanntenkreis kenne ich viele Geschichten, dass Senioren sagen: „Wenn ich einmal nicht mehr kann, dann geh ich in ein Heim.“ Aber wenn es dann so weit ist, wollen sie doch unbedingt noch weiter daheim leben. Hier sollte es mehr und durchlässigere Zwischenstufen geben. Tageszentren, betreutes Wohnen und Ähnliches sind gute Ansätze, aber zum Teil allgemein auch noch zu wenig bekannt.
Oder zu teuer, denn einen Platz in einem Seniorenwohnheim können sich die meisten ja nur dann leisten, wenn sie Pflegegeld bekommen. Einfach nur alt und vergesslich zu sein reicht nicht …
Stimmt, seit einiger Zeit bekommt man zudem vielfach nur ab einer gewissen Pflegestufe einen Platz, einfach weil nicht genug Raum vorhanden ist. Dabei würde mehr Durchmischung in diesen Einrichtungen nicht schaden, also wenn dort auch jüngere, fittere SeniorInnen wohnen würden.
Kennen Sie persönlich einen Langzeitarbeitslosen, eine Mindestsicherungsbezieherin oder Ähnliches?
Ja, und ich weiß, dass diese Situation sehr schwierig ist. Unsere Welt ist sehr leistungsorientiert. Längere Zeit nicht erwerbstätig zu sein ist aus vielen Gründen stressig. Man ist ständig damit beschäftigt, wie man mit dem knappen Geld zurechtkommt. In der Regel bleibt da kaum mehr Zeit und Energie für Dinge wie Weiterbildung oder um irgendwelche Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Und die Situation ist auch mit viel Scham behaftet, weil man „es nicht geschafft hat“. Wenn sie es sich aussuchen könnten, dann würden wohl die meisten lieber arbeiten gehen, um ökonomisch unabhängig zu sein und ein stärkeres Gefühl der Teilhabe zu haben.
Und rundherum erzählen die NachbarInnen vom Urlaub oder dem neuen Auto. Ist es nicht so, dass vor allem der Vergleich mit den Bessergestellten unzufrieden macht – sowohl im Kleinen als auch global betrachtet?
Ja, das ist auch durch Studien erwiesen. Aber die Welt ist nicht nur kleiner geworden, sondern tatsächlich auch ungerechter – vor allem, was die Vermögen betrifft. Man merkt ja, dass die Menschen unzufrieden sind. Wobei mir beim Thema Konsumgesellschaft einfällt, dass hier Bildung sehr viel bewirken kann. Nicht nur, weil man dann Zusammenhänge besser durchschauen kann, bietet Bildung auch die Basis, um etwa etwa über Nachhaltigkeit nachzudenken, den Konsumzwang zu hinterfragen und zu überlegen, was die eigenen Handlungen möglicherweise bewirken und welche Prioritäten man im Leben setzen möchte.
Linktipp:
Studie zu Armut
Astrid Fadler
Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 2/17.
Schreiben Sie Ihre Meinung an
die Redaktion
aw@oegb.at