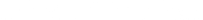Arbeit&Wirtschaft: Die Schulen sind teils holprig in den zweiten Corona-Herbst gestartet. In Wien waren kurz nach Schulbeginn bereits hunderte Klassen in Quarantäne. Wie wichtig ist nun ein Jahr mit Präsenzunterricht?
Ilkim Erdost: Ich finde, dass der Schulstart wirklich sehr verpatzt gelaufen ist, der Sommer wurde hier wieder nicht ausreichend genutzt, sowohl bezüglich der Informationen im Vorfeld als auch hinsichtlich der Vorbereitung der Teststrategie. Aber was mich am meisten ärgert an der gesamten Situation, ist, dass es wieder an den Familien und den Kindern und Schüler:innen hängen bleibt. In der Spitzenzeit waren zu Schulbeginn nur in Wien bis zu 700 Klassen gesperrt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Mit den neuen Quarantäneregelungen hat sich das ein bisschen entspannt, nichtsdestotrotz ist man wieder sehenden Auges in eine Situation gekommen, die für viele Familien und Schüler:innen, aber auch für viele Lehrer:innen und Schulleitungen unerträglich ist.
Der Präsenzunterricht oder das Lernen gemeinsam ist die Essenz von Bildung. Lernen ist ein sozialer Prozess, das wissen wir seit langer Zeit. Man hätte nie den Eindruck erwecken dürfen, dass das Arbeiten zu Hause – egal ob Distance Learning oder das Abarbeiten von Aufgaben – in irgendeiner Art und Weise das Lernen in der Gruppe oder in der Schule ersetzen oder kompensieren kann. Und wie kommen Eltern dazu, als Lehrpersonal einspringen zu müssen, das können sie auch nicht leisten. Und: Die soziale Kluft ist dadurch noch einmal sehr stark auseinandergegangen.
Kinder haben es in unserem Schulsystem grundsätzlich umso schwerer, umso weniger sie ihre Eltern beim Lernen unterstützen können. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Barrieren, wenn es um Chancengleichheit im Schulsystem geht?
Das österreichische Schulsystem hat unvergleichliche Beharrungsmechanismen. Die Welt rundherum verändert sich aber rasant. Wir stehen vor einem riesigen Strukturwandel am Arbeitsmarkt, in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir jetzt schon Freizeit verbringen – das ändert sich ja. Und die Schule nicht. Das System Schule hat es geschafft, alle Probleme, die mit dem Lernprozess oder mit dem Unterricht verbunden sind, nach außen zu delegieren. Schule tut so, als würden alle Probleme, ob es nun Lernfortschrittsprobleme sind, ob es räumliche Probleme sind, ob es Probleme sind, die mit dem Elternhaus oder der Verständigung von Prozessen zu tun haben, egal, von außen kommen.
Das österreichische Schulsystem hat unvergleichliche Beharrungsmechanismen. Die Welt rundherum verändert sich aber rasant.
Und das ist aus meiner Sicht ein Hebel, an dem ein Paradigmenwechsel ansetzen muss. Schule kann nicht delegieren. Kinder, egal woher sie kommen, egal, welchen sozialen Background sie haben, sind umfassend davon abhängig, dass Schule funktioniert und dass Schule für sie da ist. Ja, es gibt Kinder, die brauchen zusätzliche Ressourcen, da kann das Elternhaus kompensieren, da kann man Nachhilfe dazu kaufen. Aber dann gibt es Kinder, für die Schule die einzige Chance auf Teilhabe in ihrem weiteren Lebensweg ist. Schule muss daher aufhören, nach außen zu delegieren, und es braucht zweitens einen strukturellen Wandel.
Das heißt: Kinder dürfen nicht so früh getrennt werden, wie sie getrennt werden. Der Unterricht muss ganztags stattfinden. Die Schüler:innen sollen mit leeren Schultaschen wieder nach Hause gehen. All das, was Lernen und Schule betrifft, soll in der Schule stattfinden, und Schule soll so viel Freude machen, dass Schüler:innen jeden Tag gerne in die Schule gehen. Dafür braucht es auch eine andere Unterrichtskultur, die es möglich macht, dass die Schüler:innen mit ihren persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit ihren Interessen, Wünschen, Träumen wirklich im Mittelpunkt des Unterrichts und der Vermittlung stehen.

Schule sollte also nicht nur lehren, sondern auch sozialarbeiterische Aufgaben übernehmen, bei gesundheitlichen Defiziten auf physischer und psychischer Ebene eingreifen und sich um das Kind in seiner Gesamtheit kümmern?
Es geht weniger um ein Betreuen, sondern eher um das Bewusstsein, dass all diese Faktoren das Lernen der Kinder und Jugendlichen beeinträchtigen oder fördern. Ein Kind, das in einem Elternhaus lebt, das existenzielle Ängste hat, weil die Eltern nicht wissen, ob sie die Wohnung halten können oder nicht, geht mit einem anderen Rucksack in die Schule als ein Kind, das diese Sorgen von zu Hause nicht mitnehmen muss. Kinder, die Konzentrationsschwierigkeiten oder andere Lernschwierigkeiten haben, brauchen in der Schule ausreichend Unterstützung, damit hier ein Ungleichgewicht nivelliert wird. Dazu braucht es multiprofessionelle Teams aus Schulärzt:innen, Sozialarbeiter:innen, Schulpsycholog:innen, Logopäd:innen, die gemeinsam mit den Lehrpersonen den Lernfortschritt der Kinder unterstützen.
Sie haben hervorgestrichen, dass sich die Welt verändert. Da spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Im Bereich der Schule hat die Corona-Krise im Bereich Digitalisierung als Turbo gewirkt. Dabei wurde aber das Erlernen des Umgangs mit dem Computer und den verschiedenen Kommunikationstools vor allem bei jüngeren Kindern an die Eltern delegiert. Was bräuchte es hier eigentlich nun von Seiten des Schulsystems?
Die Digitalisierung ist in der Schule viele Jahre viel zu kurz gekommen. Jetzt hat es im Zuge der Pandemie einen enormen Druck gegeben, relativ schnell Strukturen aufzubauen, um Distance Learning möglich zu machen. Das ist unterschiedlich gut gelungen. Da gab es große Unterschiede, wie Lehrer:innen, wie Schulen darauf vorbereitet waren und auch, wie Schüler:innen damit umgehen konnten. Einerseits hinsichtlich der Ressourcen, aber auch hinsichtlich der Kompetenzen, die zur Verfügung gestanden sind.
Die Digitalisierung ist in der Schule viele Jahre viel zu kurz gekommen. Jetzt hat es im Zuge der Pandemie einen enormen Druck gegeben, relativ schnell Strukturen aufzubauen, um Distance Learning möglich zu machen. Das ist unterschiedlich gut gelungen.
Oft wurde darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur fehlt, einerseits in der Schule, aber auch zu Hause, dass das stabile Internet fehlt, und das stimmt. Aber es ist das leichteste, wie es jetzt auch passiert, mehrere tausend Laptops zu kaufen und sie Schüler:innen in die Hand zu drücken. Es ist aber eine völlig andere Frage, wie hier die Vermittlung verankert ist, inwiefern Lehrer:innen auch Bescheid wissen, welche digitalen Tools ihnen zur Verfügung stehen, wie sie pädagogisch damit arbeiten können, und wie die Schüler:innen zu Hause diese Dinge anwenden können. Das sind nochmal ganz andere Prozesse. Und diese brauchen Zeit.
Da und dort gibt es sehr ambitionierte Projekte und es gibt viele Lehrer:innen, die sehr engagiert sind, aber der Informatikunterricht ist an vielen Schulen vernachlässigbar und hat kaum einen Stellenwert. Die österreichischen Schulen sind nicht auf die Digitalisierung vorbereitet und die Schüler:innen auch nicht. Der digitale Wandel muss aber gestaltet werden. Und junge Menschen müssen verstehen, wie ihre digitalen Werkzeuge funktionieren, wie es um ihre Datensicherheit bestellt ist, wie sie sich sicher und kompetent in den sozialen Medien bewegen können, was Quellensicherheit bedeutet, aber auch, wie sie selbst diese digitalen Welten gestalten können. Das alles kommt derzeit viel zu kurz.
Eines der bildungspolitischen Dauerthemen ist eine adäquate Deutschvermittlung für Schüler:innen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Die einen loben hier den Lösungsansatz Deutschförderklassen, die anderen sehen ihn als verfehlt. Wie sollten Kinder mit anderer Muttersprache idealerweise Deutsch erlernen?
Die Deutschförderklassen waren eine versteckte Einsparungsmaßnahme der Bundesregierung, um Sprachförderressourcen aus den Schulen abzuziehen und in eigene Klassen zu containern. Andererseits hat man wieder einmal ein Problem externalisiert: Die fehlenden Deutschkenntnisse wurden als Problem der anderen, aber eben nicht der Schule deklariert. Das hat große Konsequenzen für die Schüler:innen, die in diesen Deutschförderklassen sind, weil ihnen damit erheblich wertvolle Zeit genommen wird in ihrem weiteren Bildungsverlauf, ihnen wird der Zugang zu den anderen Fächern genommen und ihnen wird der Kontakt zu fließend Deutsch sprechenden Kindern genommen. So verlieren sie viel Zeit.
Und in der Pandemie wurde auch nicht darauf verzichtet, die Sprachstandsfeststellungen – das betrifft großteils Volksschüler:innen – durchzuziehen. Über Maturaprüfungen und Lehrabschlussprüfungen haben wir viel gesprochen, es wurde Rücksicht darauf genommen – aus meiner Sicht eh noch viel zu wenig -, aber was die Kinder mit fehlenden Deutschfähigkeiten betrifft, auf die wurde überhaupt keine Rücksicht genommen. Sich hier nicht damit auseinanderzusetzen, wie man differenziert gemeinsam unterrichtet, halte ich für einen erheblichen Systemfehler.
Die Deutschklassen müssen so schnell wie möglich aufgelöst werden.
Sie wünschen sich also die Rückkehr zum integrativen Spracherwerb.
Ja, die Deutschklassen müssen so schnell wie möglich aufgelöst werden.

Schwer hatten es auch die Studierenden in der Pandemiezeit. Viele von ihnen hatten eineinhalb Jahre vorrangig Online-Lehre. Die Unis versuchen nun diesen Herbst, möglichst viele Lehrveranstaltungen in Präsenz anzubieten. Zudem hatte man den Eindruck, die Unis waren – im Gegensatz zur Situation der Schüler:innen – kaum Thema. Warum?
Richtig. Ich denke, dass gerade bei den Studierenden einfach angenommen worden ist, die können ja eh zu Hause lernen. Für eine kürzere Dauer stimmt das wahrscheinlich. Aber jetzt, im vierten Semester, muss man ehrlicherweise sagen, das geht nicht mehr. Und auch, wenn da das Bemühen vielleicht besteht, so viel als möglich in Präsenz anzubieten, befürchte ich ein ziemliches Chaos an den Universitäten, weil schier die räumlichen und personellen Kapazitäten dazu führen werden, dass der überwiegende Großteil der Studierenden wieder nicht in Präsenz unterrichtet werden kann. Es werden große Hörsäle nur zu einem kleinen Teil gefüllt sein, es gibt Lehrveranstaltungen mit 35 Personen, die in riesigen Hörsälen stattfinden müssen und wir können uns jetzt schon vorstellen, wie es den Studierenden geht, die nicht mehr in den Hörsaal können. Wie gedenkt man hier vorzugehen?
Aus meiner Sicht gibt es nur eine Möglichkeit, aus dieser Misere herauszukommen: Es braucht mehr Personal und mehr Vermittlung an den Unis. So wird es auf keinen Fall funktionieren.
64 Prozent der Studierenden sind außerdem berufstätig. Die sind ohnehin vor einer Situation, wo sie sehr viel rund um ihre Vereinbarkeit zwischen dem Job und dem Studium organisieren müssen, für die wird das jetzt eine Herkulesaufgabe, da gibt es auch viel zu wenig Unterstützung seitens der Universität. Aus meiner Sicht gibt es nur eine Möglichkeit, aus dieser Misere herauszukommen: Es braucht mehr Personal und mehr Vermittlung an den Unis. So wird es auf keinen Fall funktionieren.
Es braucht also mehr Ressourcen für die universitäre Lehre.
Absolut. Die Beschäftigungsverhältnisse an den Wiener Universitäten sind sowieso sehr zu kritisieren. Wir sprechen hier über Kettenverträge, über sehr unstete und teils prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist das einerseits unattraktiv, andererseits nicht zumutbar. Und unter diesen Bedingungen sich dann auch noch auf pandemische Voraussetzungen und Richtlinien einzustimmen, da braucht es schon auch eine andere Strategie der Universitäten. Wer soll da nachwachsen als Vermittlungspersonal für die Zukunft?

Chancengleichheit ist auch an den Unis bis heute Thema. Der Bologna-Prozess hat die Universitäten zudem stark verschult, die Jagd auf Credit Points, die sogenannten ECTS, steht im Vordergrund. Hat sich dieses System bewährt oder bräuchte es da eine Kehrtwende?
Der Bologna-Prozess hat die Vergleichbarkeit stark erhöht und auch in der Vermittlung zumindest Standards gesetzt hat, auf die sich Studierende darauf verlassen können, dass sie die einfordern dürfen – das ist ein Vorteil. Andererseits ist viel an Diskursmöglichkeiten, an Wahlmöglichkeiten ausgeschlossen worden. Das fehlt der Lehre und das fehlt auch den Universitäten. Aber insgesamt ist das größte Problem, das die österreichischen Universitäten im Moment haben, der Betreuungsschlüssel. Es braucht mehr Lehrpersonal. Derzeit wird versucht, bei den Nachwuchslehrenden so viel wie möglich rauszupressen und einzusparen, um sich die höheren Ebenen personell leisten zu können. Das geht nicht. Da braucht es einen Paradigmenwechsel, da braucht es eine bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten.
Derzeit wird versucht, bei den Nachwuchslehrenden so viel wie möglich rauszupressen und einzusparen, um sich die höheren Ebenen personell leisten zu können. Das geht nicht.
Stichwort Betreuungsschlüssel: Inzwischen gibt es in immer mehr Studienrichtungen Aufnahmeprüfungen mit dem Versprechen, dass es dann für die Studierenden, die einen Platz bekommen, eine gute Betreuung gibt. Stellen aber nicht diese Aufnahmeverfahren wieder eine massive Barriere dar und verschlechtern die Chancengleichheit beim Zugang zu höherer Bildung?
Ja. Und der Zugang ist auch nicht fächerspezifisch. Ich kann immer standardisierte Tests überall einziehen, tatsächlich ist aber entscheidend, sowohl beispielsweise in der Rechtswissenschaft als auch in der Medizin, mit welcher Haltung junge Menschen in dieses Studium eintreten. Ich finde, man braucht nicht so zu tun, als ob persönliche Wertehaltungen und auch Ansprüche irrelevant wären für den Medizinberuf oder für die juristische Karriere. Das spielt aber keine Rolle. Und insofern halte ich diese ganzen standardisierten Verfahren für nicht besonders aussagekräftig. Eher muss man wirklich darauf achten, dass ausreichend Studienplätze zur Verfügung stehen und dass ausreichend Personal zur Verfügung steht.
Wir brauchen die akademisch ausgebildeten Menschen. Es ist nicht so, dass das ins Blaue hinein gewünscht wäre, sondern wir haben hier in Österreich einen massiven Aufholbedarf. Eher müsste man sich Gedanken machen, wie man längerfristig in den nächsten zehn, zwanzig Jahren gedenkt, in verschiedenen Sparten den Anteil von Akademiker:innen anzuheben und wieviel Geld man dafür in die Hand nehmen muss. Natürlich ist das ein Thema, das die Universitäten nicht alleine lösen können, aber sie können hier Stichwort- und Impulsgeberinnen für die Politik sein und da vermisse ich ihre Initiativen.