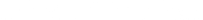In die elektronische Robbe ist richtig viel Arbeit hineingeflossen. Seit 1993 wird an ihr geforscht. Erst Anfang der 2000er-Jahre wurde sie an erste Pflegeheime ausgeliefert. Paro ist somit ein Prototyp eines Phänomens, welches als „Digitalisierung der Pflege“ bezeichnet wird. Dahinter steckt die Idee, in der Pflege eine gewisse Technisierung einzusetzen. Über Sinnhaftigkeit, Möglichkeiten und Grenzen dieser Technisierung wird seit Jahren in Fachkreisen diskutiert. Die Arbeiterkammer fördert über ihren Digitalisierungsfonds Projekte, die sich mit Digitalisierungsprozessen – nicht nur, aber auch – im Pflegebereich auseinandersetzen. Und nicht zuletzt auf die COVID-19-Pandemie reagierten zahlreiche Branchen mit einem Digitalisierungsschub – und zwar auch der Pflegebereich. Was ist nun unter diesem Begriff der „Digitalisierung“ zu verstehen? Schließlich wird er derzeit in der öffentlichen Debatte als Zauberwort für die angebliche oder tatsächliche Lösung aller möglichen Probleme verwendet. Glaubt man Kurt Schalek, Experte für Pflegepolitik der AK Wien, dann handelt es sich tatsächlich um ein weites Feld: „Es geht hier um eine riesige Summe an Technologien, zum Beispiel Informations- oder Kommunikationstechnologie oder Robotik.“ Hier sei eine wesentliche Frage, ob es Technologien gebe, die Pflegekräften bei der Arbeit oder zu pflegenden Menschen zu einer größeren Autonomie verhelfen können. „Ein Beispiel für Letzteres ist ein Roboterarm, der beim Waschen hilft“, so Schalek. „Das ist vielen Leuten lieber als Hilfe durch eine menschliche Pflegekraft, weil die Intimsphäre gewahrt bleibt.“
Es gibt diese Fantasie, dass es eine
Technologie gibt, die das wachsende
Personalproblem in der Pflege löst.
Kurt Schalek, Experte für Pflegepolitik der AK Wien
Führen nun also eine therapeutische Robbe oder ein bei der Körperpflege behilflicher Roboterarm zu einer Maschine, die mittelfristig eine Pflegekraft komplett ersetzen könnte? Hier verneint Schalek kategorisch. „Es gibt diese Fantasie, dass es eine Technologie gibt, die das wachsende Personalproblem in der Pflege löst. Es gibt dieses Bild vom Pflegeroboter, das ist von der Realität aber sehr weit weg.“ So sei es sehr schwierig, Maschinen selbst grundlegendste Tätigkeiten beizubringen, die für Menschen selbstverständlich seien. „Der Aufwand, bis ein Gerät lernt, mir ein Glas Wasser zu reichen, ist sehr groß. Das ist schon eine tolle technische Leistung, aber noch lange kein Pflegeroboter.“ Schalek möchte an dieser Stelle eine grundsätzlichere Frage aufwerfen: „Es gibt in der Pflege immer weniger Zeit für den Menschen. Die Zeit, die den Pfleger:innen gegeben ist, ist die Zeit, die es braucht, bestimmte Handgriffe zu tätigen. Dies und die Idee des Pflegeroboters ist ein tayloristischer Ansatz, der aus der Industrie kommt.“

Pflegearbeit 4.0
Und doch gibt es in der Wissenschaft inzwischen den Begriff der „Care Work 4.0“, zu Deutsch, der „Sorgearbeit 4.0“. Wobei der Begriff der Sorge hier weit gesteckt ist und von Kinderbetreuung über Kranken- bis zur Altenpflege alle pflegenden und betreuenden Arbeiten am Menschen einschließt. Die Wissenschafter:innen Nina-Sophie Fritsch, Christian Berger und Katharina Mader beobachten sogar eine „Transformation von bezahlter Sorgearbeit in Zeiten von Digitalisierung und Corona“, wie sie in einem neuen Policy Paper für die Arbeiterkammer im Jänner 2022 schreiben. Durch die COVID-19-Pandemie werde „ein Prozess vorangetrieben, der rasante Digitalisierungsfortschritte mit sich bringt und fast alle Lebensbereiche (Familie, Beruf, Freizeit, Bildungssystem, Gesundheitswesen) umfasst“. Zwar sei Digitalisierung ein Trend, der „meist in der Industrieproduktion thematisiert wird“. Doch auch „in den mehrheitlich von Frauen ausgeübten körpernahen Dienstleistungen oder in den Pflegeberufen ist ein rasanter Digitalisierungszuwachs durch Assistenz- und Dokumentationstechnologien zu beobachten“, schreiben die Autor:innen.
Für eine genauere Erörterung dieser These treffen wir zwei der Autor:innen, nämlich die Soziologin Nina-Sophie Fritsch und Christian Berger, der als wirtschaftspolitischer Referent bei der AK Wien tätig ist. Corona-bedingt findet die Unterhaltung auf dem Dach der AK Wien statt. „Pflege ist ein wichtiges Thema für die Zukunft“, sagt Berger. „Wir werden alle älter werden. Bis 2030 werden 75.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht werden. Das ist ein großes versorgungsökonomisches Problem.“
Und kann der im Policy Paper beschriebene Digitalisierungszuwachs helfen, daran etwas zu ändern? Zunächst sei anzuerkennen, dass der Großteil der Pflegearbeit von Privatpersonen und somit unbezahlt ausgeübt werde, großteils von Frauen, erklärt Nina-Sophie Fritsch. „Und dann muss gesagt werden, dass der Care-Sektor wahnsinnig arbeitsintensiv ist. Nacht- und Intensivpflege bedeutet Nacht-, Schicht- und Schwerarbeit. Der Begriff ‚schwere körperliche Arbeit‘ wird immer für männlich dominierte Arbeit verwendet, bei der Pflege gar nicht. Und hier lassen sich gerade die akademischen Gesundheitsberufe nicht durch Automatisierung ersetzen. Es handelt sich hier um passgenaue Arbeit am Körper, das können Maschinen nicht leisten.“ Digitale Technik komme hauptsächlich in einer unterstützenden Funktion zum Einsatz, ergänzt Berger. „Es sind viele Apps im Einsatz, die von Pfleger:innen verwendet werden. Oder es gibt ein Glas mit Sensoren, die messen können, ob ein:e Klient:in auch genügend Wasser zu sich nimmt.“

Auch Fritsch beschreibt an dieser Stelle einen tayloristischen Ansatz, nicht nur im Pflegebereich, sondern im gesamten Gesundheitswesen, der immer stärker um sich greife: „Pfleger:innen kritisieren dieses System ja. Sie empfinden es als entfremdet, immer weniger Zeit zu haben, sich um ihre Klient:innen kümmern zu können. Alles wird auf ihnen abgeladen. Es gibt einen systematischen Druck, der entsteht, wenn ich ein Krankenhaus so betreibe wie einen metallverarbeitenden Betrieb.“
Fritschs Kollege Christian Berger sieht hier die dringende Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung, als deren Ergebnis die Pflegearbeit viel stärker wertgeschätzt wird als bislang. Dafür brauche es unter anderem kürzere Arbeitszeiten und höhere Löhne für das Personal: „Die reproduktiven Kapazitäten der Gesellschaft müssen gestärkt werden und als Teil einer sozial-ökologischen Infrastruktur betrachtet werden. Lebensgefährdende Arbeiten in der Rüstung werden hoch bezahlt, während pflegende Tätigkeiten, die Leben ermöglichen, niedrig bewertet werden.“
Pflegekräfte haben Redebedarf
Über solche und andere Fragestellungen gebe es tatsächlich unter Pflegekräften großen Redebedarf, erzählt die Professorin und Politikwissenschafterin Stefanie Wöhl von der Fachhochschule FH-BFI Wien. Unterstützt vom Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer führte sie Interviews mit Heimhilfen und Krankenpfleger:innen bei der Caritas Socialis durch. Dabei ging es um die Fragestellung, wie Apps den Pflegealltag erleichtern können und in der mobilen Pflege gehandhabt werden. „Die Gespräche waren wirklich sehr spannend“, sagt Wöhl. „Sie gingen teilweise weit über die Digitalisierung hinaus. So haben viele erzählt, dass es am Anfang der Pandemie nicht genügend Masken für das Personal gab.“
Weiters sei in den Interviews mit den Beschäftigten herausgekommen, dass der persönliche Kontakt mit Klient:innen und Angehörigen das Wichtigste sei. „Wir haben zum Beispiel überlegt, ob eine Online-Plattform für Angehörige Sinn macht. Aber da haben viele gesagt, dass das persönliche Gespräch wichtig sei, um Berechenbarkeit für die zu pflegenden Personen zu erzeugen.“ Ein großer Wunsch bestehe jedoch nach Arbeitserleichterungen, die teilweise mit der Pandemie zum Durchbruch gelangt seien. „Rezepte konnten jetzt online zur Apotheke geschickt werden“, sagt Wöhl. „Das war eine große Erleichterung, und es besteht die Hoffnung unter den Beschäftigten, dass das erhalten bleibt. Auch ein digitaler Einkaufszettel, den Klient:innen direkt an das Handy der Heimhelfer:innen schicken, wäre eine Erleichterung.“

Doch auch Probleme mit neuen digitalen Arbeitsweisen kamen zur Sprache. „Es ist schwieriger, eine Pflegedokumentation am Diensthandy zu machen. Die haben ein sehr schmales Display, es ist nicht einfach zu tippen.“ Und welche Wünsche werden von den Kolleg:innen geäußert? „Viele Beschäftigte wollen digitalen Zugriff auf die Dienstpläne der Kolleg:innen haben, um sich untereinander besser absprechen zu können.“

etablierter als früher, auch um Ansteckungen zu vermeiden.“ | © Markus Zahradnik
Zoom ohne Ansteckung
Sehr konkret befasst mit Digitalisierungsprozessen im Arbeitsalltag ist Anette Jelen-Csokay, Chief Digitalisation Officer im Haus der Barmherzigkeit, den Altenpflegeheimen in Wien, mit 2.000 Mitarbeiter:innen. „Ein springender Punkt bei der Umsetzung erfolgreicher Digitalisierungsmaßnahmen ist das Budget“, sagt sie. „Es gibt viele tolle Ideen, aber sie müssen auch finanziert werden. Der Pflegenotstand übersetzt sich auch in die zur Verfügung stehende Infrastruktur.“
Mit der Pandemie habe sich bei dieser Infrastruktur viel geändert. „Wir haben in kürzester Zeit auf Homeoffice umgestellt, wo es möglich war. Wir mussten Videokonferenzen ermöglichen. Die werden von den Stationsleitungen sehr geschätzt. Sie wollen ihre Meetings nur mehr über Teams machen, weil es weniger Ansteckungsgefahr bedeutet.“ Dies sei eine sehr spannende Erfahrung gewesen. „Man hat immer gesagt, das wird in der Pflege nie funktionieren. Jetzt gibt es aber eine große Offenheit.“
Abseits von Corona war das größte Projekt der vergangenen Monate die Erstellung einer digitalen E-Learning-Plattform für die Mitarbeiter:innen. „Das wurde auf der Basis einer 60-seitigen analogen Mappe erstellt. Die haben neue Kolleg:innen vorher zu Beginn ihres Dienstverhältnisses in die Hand gedrückt bekommen. Ich habe keine Ahnung, wer das überhaupt gelesen hat.“ Nun gebe es ein Online-Angebot mit kurzen Videos, die bei Bedarf angeschaut werden können. „Es müssen kurze Videos sein, da die Kolleg:innen nicht die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Und sie können immer wieder angeschaut und abgefragt werden.“

Dieses neue digitale Onboarding-Programm soll nicht nur im Haus der Barmherzigkeit, sondern in allen Einrichtungen des Dachverbandes Wiener Sozialeinrichtungen zum Einsatz kommen. Für Jörg Schörgmayer, dem Zuständigen für Betriebswirtschaft und Digitalisierung im Dachverband ist dies erst der Beginn eines viel umfassenderen Transformationsprozesses. „Es gibt eine tiefgehende Änderung der Gesellschaft. Auch Dienstleistungen werden dem Wandel unterzogen. Und da bin ich als Verband gerne bei den technologischen Entwicklungen im Driving Seat, bevor ein Konzern wie Amazon es macht.“
Das digitale Onboarding-Programm ist für Schörgmayer ein gutes Beispiel dafür, wie digitale Technik den Arbeitsalltag verbessern kann. „Zum Beispiel ist ja gerade die mobile Pflege sehr herausfordernd. Sie benötigt eine große Eigenständigkeit der Kolleg:innen. Sie fahren zu den Klient:innen und erleben dort immer wieder neue Situationen, ohne Back-up wie im stationären Bereich. Da kann die Onboarding-App vom ersten Arbeitstag helfen, Fragen zu beantworten, zum Beispiel dazu, wie ich mit schwierigen Klient:innen umgehe.“ Dieses Tool sei nicht nur für die großen Akteure im Pflegebereich, wie zum Beispiel die Caritas, sinnvoll. „Es kann auch kleinen Organisationen bei der Ausbildung von ehrenamtlichen Helfer:innen unterstützen.“
Insgesamt befürwortet Schörgmayer eine größere Rolle für digitale Apps im Pflegebereich. „In Deutschland sehen wir immer mehr den Trend, digitale Leistungen als Gesundheitsleistungen anzuerkennen“, sagt er. „Dort gibt es die App auf Rezept, etwa wenn mir eine bestimmte App bei der Burnout-Prävention helfen soll. In Österreich bieten die Gesundheitskassen das leider noch nicht an.“
Auch eine Flexibilisierung der Pflegearbeit werde durch die Digitalisierung möglich, meint Schörgmayer. „Zum Beispiel, wenn eine Klientin noch den ‚Tatort‘ schauen möchte. Dann könnte sie ihrer Pflegekraft über eine App eine Nachricht schicken, dass sie erst nach 21.45 Uhr kommen soll.“ Aber bräuchte es dann nicht viel mehr Personal, um eine solche Flexibilisierung abzudecken? „Das muss sich zeigen“, meint Schörgmayer. „Insgesamt brauchen wir eine Diskussion darüber, wie viel uns die Pflege und deren Modernisierung als Gesellschaft wert ist und wie viel wir dafür zahlen wollen.“

Drei Fragen zum Thema
Welche ethischen Aspekte sind zu beachten?
Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung wird mehr möglich, um pflegebedürftigen Menschen Hilfestellungen in ihrem Alltagsleben zu geben. So können Sensoren messen, ob eine Person genug trinkt, ob sie gerade aus dem Bett aufgestanden oder ob die Inkontinenzhose vollgelaufen ist. Dies ermöglicht Pfleger:innen, flexibel zu helfen und gegebenenfalls einzugreifen. Allerdings handelt es sich hier auch um den Einsatz von Überwachungstechnologien im Pflegebereich. Überwachung ist jedoch eine freiheitsbeschränkende Maßnahme. Eine gesellschaftliche Debatte darüber, wann und in welchem Ausmaß solche Überwachung legitim ist, steht noch aus.
Hat die Digitalisierung in der Pflege eine Geschlechterdimension?
Ja. Denn Pflegeberufe werden überwiegend von Frauen ausgeübt. Sie gelten als dienende, traditionell weiblich gelesene Tätigkeiten am Menschen, die traditionell niedrig entlohnt werden. Dies steht im Gegensatz zu traditionell besser entlohnten Fachkräften in der Industrie, mehrheitlich Männer. Die Digitalisierung bringt größeres technisches Know-how in die Pflegeberufe, was sich in höheren Löhnen widerspiegeln sollte. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass der „Wert“ der Pflege nur an den männlich besetzten Technologien, nicht aber an der Pflegearbeit an sich bemessen wird. Geschlechterrollen würden so reproduziert.
Ermöglicht Digitalisierung mehr Flexibilität?
Neue Technologien können eine passgenauere Pflege ermöglichen. Allerdings hat die COVID-Krise den Personalmangel im Pflegebereich schmerzhaft aufgezeigt. Die Bevölkerung wird älter. Es braucht schon jetzt mehr Personal, um das bestehende Pflegeniveau zu halten. Eine individueller gestaltete Pflege bräuchte entsprechend noch mehr Personal. Und dafür müsste der Staat Geld in die Hand nehmen.
Weiterführende Artikel:
Pflege- und Betreuungsnotstand: weitere Verschärfungen drohen
Die „wahren Leistungsträger:innen“ in der Corona-Krise: Was hat sich seither verändert?