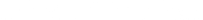„Real-life problems“
Zumindest Selma Prodanovic hat andere Ansprüche an Start-ups. Interessant seien für sie jene, die „real-life problems“ lösen wollen. Als „schönstes Beispiel“ dafür nennt sie die App „mySugr“, die von Diabetes-PatientInnen auf die Beine gestellt wurde, um den Alltag mit der Zuckerkrankheit zu erleichtern: „Die Gründer hatten selbst ein Problem und haben auf der Fun-Ebene eine Lösung gefunden.“ Im Vordergrund stehe nicht nur die „Technologie mit Profit“, sondern jene „mit Purpose“, betont der Business Angel.
Und doch müssen auch Business Angels Geld verdienen, denn wie Prodanovic selbst betont: Sie sind keine PhilanthropInnen. Doch auch abgesehen davon scheint es ein legitimer Anspruch zu sein, dass Start-ups keine Spielwiese sind. Nicht zuletzt investiert auch der Staat einiges an Geld in diesen Sektor.
Einen völlig anderen Zugang könnte von daher Crowdfunding bieten. Die Idee: Interessierte oder künftige KonsumentInnen geben Geld aus, um einer Idee, die sie für sinnvoll halten, auf die Welt zu helfen. Damit wird sichergestellt, dass Bedürfnisse nicht erst über kostspielige Marketingmaßnahmen geweckt werden müssen, um die entsprechenden Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen. Die Vielzahl an Finanziers sorgt dafür, dass die MacherInnen nicht von Einzelinteressen gesteuert werden, sondern ihren eigenen Weg gehen können – ganz ohne allzu hochgestochene Profiterwartungen erfüllen zu müssen.
Einen Schritt weiter geht der Investor Nikolaus Hutter mit dem Konzept der „Impact Economy“, das er in der Wiener Sky Lounge präsentiert: Die Millennials oder Generation Y suchen nach Sinn in ihrer Arbeit und wollen vor allem keine Produkte mehr kaufen, die unter Ausbeutung von Menschen oder der Umwelt erstellt werden. Deshalb müsse die Start-up-Szene umdenken: Zukunft hätten Start-ups nur, wenn sie auf diese Bedürfnisse Rücksicht nehmen – und somit auch Investoren, wenn sie diesen Anspruch an die Stelle von alleinigen Profitinteressen stellen.

Lösungen und Spaß
Start-ups setzen nur auf Entertainment, die Investoren wollen nur das große Geld, für große Unternehmen sind Start-ups nur Auslagerungen im anderen Gewand: In all diesen Vorwürfen stecke ein Körnchen Wahrheit, gesteht Prodanovic ein. Sie hält die europäische Szene aber für durchaus bodenständiger: „In den USA gibt es Investoren, die offen sagen: ‚We are in the exit-business.‘“ Sprich: Sie streben nach den großen Gewinnen, die ein Exit/Verkauf eines erfolgreichen Start-ups mit sich bringt. Ihr hingegen gehe es um die „Lösungen, die daraus entstehen“ – und um den Spaß, den viele GründerInnen zweifellos versprühen.
Doch wie steht es eigentlich um die Rechte und Arbeitsbedingungen von ArbeitnehmerInnen? Sind Start-ups wirklich imstande, Jobs zu schaffen? Zumindest auf die letzte Frage antwortet Prodanovic kategorisch: „Auf jeden Fall.“ Die Investitionen ihres Kollegen Hansi Hansmann hätten jedenfalls 500 Arbeitsplätze geschaffen. Der Großteil der neuen Arbeitsplätze gehe auf das Konto von Start-ups oder EPUs (mehr dazu siehe „Das unbekannte Wesen“ und „Start-ups als Beschäftigungsmotor?“). Was die Bezahlung und Arbeitsbedingungen betrifft, beruft sie sich auf allgemeine Prinzipien. „Das ist eine besondere Welt, das muss man wollen“, sagt sie. Und immerhin werde niemand gezwungen, dort zu arbeiten. Wenn man sich aber dafür entscheide, lohne sich das jedenfalls: „Ein oder zwei Jahre in einem Start-up gearbeitet zu haben, das ist eine großartige Erfahrung. Man kann dabei sein, wie etwas Neues entsteht.“
Dann wechselt sie die Position. „Ein Start-up zu gründen ist keine leichte Entscheidung“, hält sie fest. Für jede/n GründerIn sei es schmerzhaft, wenn die beste Idee dann doch nicht reüssiert: „Da hat man Blut geleckt und muss einen lnsolvenz- oder Konkursantrag stellen. Das macht man sicher nicht leichtfertig.“ Auch würden die ArbeitnehmerInnen nicht in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen.
Großer Diskussionsbedarf
Der große Hype um die Start-ups scheint von daher ebenso berechtigt wie unberechtigt. Berechtigt deshalb, weil sie in der Tat ein Innovationspotenzial haben, das sehr wohl dem Anspruch der Weltverbesserung Genüge tun kann. Unberechtigt, weil die Frage der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung von ArbeitnehmerInnen allzu sehr auf die leichte Schulter genommen wird. Was nach dem Streifzug bleibt, ist jedenfalls eine Menge Diskussionsbedarf.
Sonja Fercher
Christian Bunke
Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 5/17.
Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
sonja.fercher@oegb.at
die Redaktion
aw@oegb.at