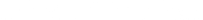Ein neues Gesetz gegen digitale Monopole
Der DMA adressiert ganz konkret die großen Player im Internet. Das neue Gesetz nennt sie auch „Gatekeeper“ (siehe Kasten). Zum Gatekeeper werden Unternehmen und deren Plattformen, wenn sie eine solche Marktmacht auf sich vereinen, dass ihre Stellung zementiert ist. Wenig überraschend sind das die bekannten Tech-Riesen Apple, Amazon, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, der Facebook-Konzern Meta und der chinesische Konzern Bytedance (TikTok).

Auffällig ist, dass die Unternehmen mit Ausnahme von Bytedance (China) alle aus den USA kommen. „Europäische Unternehmen zählen nicht zu diesen großen Playern. Aber wir wollen versuchen, einen fairen Wettbewerb herzustellen, an dem auch kleinere Unternehmen teilnehmen können. Der ist durch die Monopolisierung und Oligopolisierung nicht gegeben. Die muss man aufweichen, um Zugang zum Markt herzustellen“, erklärt Heidi Scheichenbauer, Senior Consultant beim Research Institute.
Der Erfolg dieser Gatekeeper basiert nicht allein auf den klassischen Mechanismen des Marktes – also das beste Produkt zum besten Preis. Er hat auch viel damit zu tun, dass sie den Algorithmus kontrollieren, mit dem sie Konkurrenzangebote ausspielen. Dass sie Mitbewerber:innen horrende Gebühren abknöpfen oder gleich ihre Produkte kopieren. Nutzer:innen können auch bestimmte Anwendungen oft nicht deinstallieren und werden außerhalb der Anwendung mit gezielter Werbung verfolgt, ohne dieser Art der Datennutzung je zugestimmt zu haben.
Vom Marktversagen zur Digitalstrategie
„Im digitalen Bereich stellen wir ein Marktversagen fest. Freier Wettbewerb ist hier oft nicht möglich, weil durch Netzwerkeffekte Monopolstellungen entstehen. Die großen Player wie Alphabet, Meta und andere haben hohe Skaleneffekte dadurch, dass sie Plattformen bereitstellen und dort die Wettbewerbsbedingungen steuern“, bringt es Scheichenbauer auf den Punkt. Wem das alles bekannt vorkommt, der denkt wahrscheinlich an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Sie war der erste Versuch der EU, etwas mehr Kund:innenschutz im Internet zu implementieren. Mit gemischten Ergebnissen. Große Unternehmen interpretierten die viel zu geringen Strafzahlungen eher als lästige Gebühr, die bei Verstößen eben fällig wird. „Man hat gemerkt, dass die DSGVO als erster Rechtsakt, bei dem es auch um Digitalisierung ging, nicht ausreicht. Immer wieder hat man nach Gerichtsverfahren gesehen, dass die großen Plattformen auch bei relativ hohen Strafen nur mit den Schultern gezuckt haben, und dass die EU ihre Gesetze allein mit den Mitteln des Datenschutzes und des klassischen Wettbewerbsrechts nicht durchsetzen kann“, fasst Tünde Fülöp die Situation zusammen. Sie arbeitet im Büro für digitale Agenden der Arbeiterkammer. Jetzt hat die EU umfassend reagiert. Im Rahmen ihrer Digitalstrategie gab es gleich sechs neue Gesetze (siehe Kasten), die im Verbund ein juristisches Fundament für das Internet bilden sollen.
Wie der Digital Markets Act eingreift
Aufgabe des DMA ist es, einen fairen Wettbewerb bei digitalen Diensten und bessere Chancen für neue Rivalen zu schaffen. Zentral sind dabei vier neue Pflichten für die Gatekeeper. Erstens: Drittanbietern muss es möglich sein, mit den Diensten der Großen zusammenzuarbeiten. Meta muss also ermöglichen, dass Signal- oder Threema-User:innen Nachrichten an WhatsApp-User:innen schicken können. Punkt zwei ist, dass Firmen, die auf den Plattformen der Gatekeeper unterwegs sind, ihre selbst generierten Daten abrufen können.

Drittens müssen Gatekeeper es zulassen, dass Nutzer:innen auch außerhalb ihrer Plattform Verträge mit Drittanbietern abschließen. Das bedeutet beispielsweise, dass ich Abos von Anwendungen auch direkt bei dessen Entwickler abschließen kann und das nicht mehr über Apple oder Google tun muss. Punkt vier: Firmen, die Werbung auf einer der großen Plattformen schalten, bekommen zukünftig alle Instrumente und Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um den Erfolg oder Misserfolg ihrer Werbung nachvollziehen zu können.
Wie auch User:innen profitieren
Diese Pflichten kommen vor allem anderen Unternehmen zugute. Doch auch die User:innen profitieren. Denn zusätzlich zu diesen Pflichten erlegt der DMA den Gatekeepern auch gleich noch einige Verbote mit auf. Dazu gehört, dass die Tech-Riesen auf ihren Plattformen die Angebote Dritter gleichberechtigt stehen lassen müssen. Sie dürfen also bei der Reihung der Ergebnisse nicht benachteiligt werden. Nutzer:innen haben außerdem zukünftig das Recht, die Apps der Großen zu deinstallieren. In vielen Fällen war das bisher nicht möglich.
„Der DMA ist ein Teil des Digitalpakets, das Abhilfe schaffen will, und bezieht sich auf Wettbewerb und Märkte. Mit Vorab-Verpflichtungen für die Plattformen sollen Rechte besser geschützt werden. Konsument:innen kommt das direkt und indirekt zugute“, so Fülöp. Das bedeutet, dass nicht erst nach einem Verstoß mühsam und langwierig der Rechtsbruch bewiesen werden muss. Die Gatekeeper stehen schon vorher in der Verantwortung. Für Fülöp ist das ein zentraler Aspekt des DMA. Denn er hilft Konsument:innen und Mitbewerber:innen dabei, leichter zu ihrem Recht zu kommen. „Digitale Souveränität wird immer als Infrastruktur verstanden. Sie beinhaltet aber auch die Durchsetzung von Gesetzen. Deswegen ist digitale Souveränität nicht gegeben, wenn die Plattformen, die außerhalb Europas sitzen, so tun, als sei die digitale Welt der Wilde Westen.“

Dafür zuständig ist übrigens die Europäische Kommission – nicht die lokalen Wettbewerbsbehörden. „Der wichtigste Unterschied zur DSGVO ist für mich, dass die Durchsetzung zentral – also nicht über personell unterbesetzte nationale Behörden – abläuft. Die Europäische Kommission ist zuständig und hat schon begonnen, Strukturen aufzubauen und erste Verfahren einzuleiten. Das könnte ein Gamechanger sein“, so Fülöp.
DMA sieht drastische Strafen vor
Um – anders als bei der DSGVO – eine abschreckende Wirkung zu erzielen, hat die EU beim DMA teils drastische Strafen vorgesehen. Zum einen gibt es Geldbußen, die bei bis zu zehn Prozent des globalen Gesamtumsatzes des Unternehmens liegen, sollte es ein erster Verstoß sein. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen sind dann bis zu zwanzig Prozent möglich. Dazu kommen mögliche Zwangsgelder von bis zu fünf Prozent des Tagesumsatzes. Letztes Mittel der EU sind die sogenannten „Abhilfemaßnahmen“. Sie werden bei systematischen Verstößen durchgesetzt und können bis zur Veräußerung bestimmter Geschäftsbereiche gehen.
Entsprechend streitwillig zeigen sich die Gatekeeper. „Die ersten Verfahren gegen zentrale Plattformbetreiber laufen schon. Und sie werden sich rechtlich dagegen wehren, das kennt man von der DSGVO“, erzählt Scheichenbauer aus der Praxis. Und weiter: „Ein großes Thema ist, wie ein ‚zentraler Plattformdienst‘ definiert wird. Wann sind Schwellenwerte erfüllt, und wie grenzt man den Begriff ab? Alles, was etwas schwammig formuliert ist, kann man unterschiedlich auslegen. Da wird es viele Versuche geben, rauszukommen aus dem Anwendungsbereich des DMA.“
Chance für kleinere europäische Unternehmen
Aus Sicht von Scheichenbauer seien tatsächlich viele Begriffe im DMA eher schwammig formuliert. Ein Zeichen dafür, dass sich die Verantwortlichen nicht immer einig gewesen seien. Der tendenzielle unklare Normtext würde dann eben einfach mit Interpretationshilfen ergänzt. Hier wird erläutert, was die Absicht der Regelungen ist. Und die ist aus Sicht von Scheichenbauer glasklar. „Ich sehe schon, dass die Vielfalt dadurch gefördert wird und auch kleinere europäische Unternehmen die Möglichkeit bekommen, zu partizipieren. Das war bislang schon möglich, aber nur, wenn man sich den Bedingungen der Anbieter gebeugt hat. Den DMA sehe ich als große Chance.“
Die sechs „Gatekeeper“ laut EU:
- Alphabet: Google-Maps, -Play, -Shopping, -Search, -Ads, YouTube, Android, Chrome
- Amazon: Marketplace, Amazon-Ads
- Apple: App-Store, iOS, Safari
- ByteDance: TikTok
- Meta: Meta-Marketplace, -Ads, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger
- Microsoft: LinkedIn, Windows PC OS
Google Gmail, Microsoft Outlook und der Samsung Internet-Browser erfüllen zwar rein quantitativ die Voraussetzungen, um als Gatekeeper zu gelten. Allerdings nicht qualitativ.
Sechs EU-Gesetze sollen das Internet wettbewerbsorientierter, sicherer und nutzer:innenfreundlicher gestalten:
- Digital Markets Act (DMA): Soll für faire und offene Märkte im digitalen Sektor sorgen.
- Data Governance Act (DGA): Grundstein für den Aufbau eines europäischen Datenaustauschmodells.
- Data Act oder Datengesetz: Soll dazu beitragen, den bislang ungenutzten Wert an Daten in der EU auszuschöpfen und hält fest, wer welche Daten verwerten darf.
- Artifical Intelligence Act (AIA): Stellt neue rechtliche Anforderungen an den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
- Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA): Enthält Vorschriften zur Haftung von Providern, zur Meldung illegaler Inhalte und legt Pflichten für Online-Dienste fest.
- Cyber Resilience Act (CRA): Hat das Ziel, die Cybersicherheit von IT-Produkten zu verbessern.