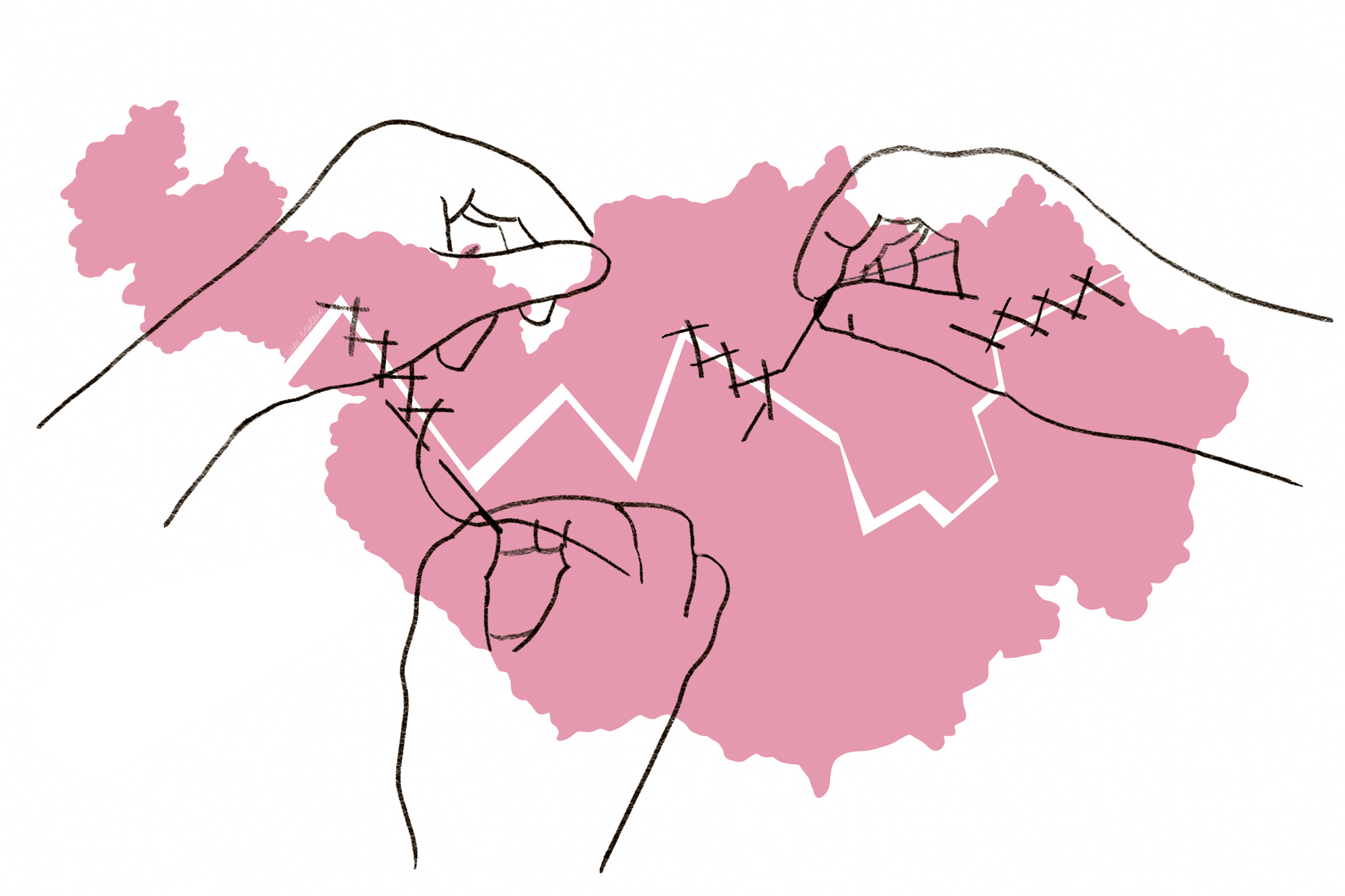Mit dieser Belastung steht Hassan nicht alleine da. Laut dem „So geht’s uns heute“-Barometer von Statistik Austria und dem Sozialministerium erwarteten Ende vergangenen Jahres 14 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Zahlungsschwierigkeiten bei Wohn- oder Energiekosten. Zwei Drittel blickten pessimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Auch ein Blick auf die Wirtschaftsdaten erhärtet diese Sorgen: Österreich befindet sich laut Prognosen für heuer im dritten Rezessionsjahr in Folge. Die Arbeitslosigkeit bleibt hoch. Die Lebensmittelpreise sind laut ÖGB seit 2021 um mehr als ein Drittel gestiegen. Zeitweise wies Österreich die höchste Inflationsrate der Eurozone auf.
Finanzminister Markus Marterbauer brachte es in seiner Rede zum Doppelbudget Mitte Mai auf den Punkt: „Dem Budget geht es nicht gut, weil es der Wirtschaft in den vergangenen Jahren schlecht gegangen ist.“ Und aktuell liegt das Budgetdefizit bei 4,7 Prozent.
Bevölkerung entlasten
Gute Wirtschaftspolitik bedeutet aber viel mehr, als rote oder schwarze Zahlen zu schreiben. Sie entscheidet, ob Menschen ihre Stromrechnung begleichen, sich weiterbilden oder einen neuen Job finden können. Wie lassen sich also die aktuellen und künftigen Herausforderungen meistern? Und wie können wirtschaftspolitische Maßnahmen jetzt so gestaltet werden, dass sie sich positiv auf den Alltag der Menschen auswirken?

Antworten hat unter anderem Angela Pfister, Ökonomin in der volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB. Sie fordert mehr Transparenz in der Wertschöpfungskette, um nachvollziehen zu können, warum Preise steigen. Im Vergleich zum allgemeinen Anstieg der Preise um 26 Prozent sind etwa die Lebensmittelpreise seit 2021 um 33 Prozent gestiegen. „Es braucht eine Antiteuerungskommission und ein umfassendes Preismonitoring-System nach dem Vorbild Frankreichs“, fordert Pfister. Ziel sei es, zu verhindern, dass Unternehmen Preise ungerechtfertigt über die Kostenanstiege hinaus erhöhen.
Zentrales Thema Energiekosten
Die von der Regierung geplante Mietpreisbegrenzung begrüßt Pfister als guten ersten Schritt. 2025 sollen Erhöhungen bei Richtwert- und Kategoriemieten ausgesetzt werden. 2026 ist laut Regierungsprogramm eine Erhöhung um maximal 1 Prozent, 2027 um maximal 2 Prozent vorgesehen. Auch danach soll sie beschränkt bleiben. Doch die Ökonomin betont: „Es braucht unbedingt Nachbesserungen: Der private Neubau muss miteinbezogen werden, sonst bleibt der Effekt begrenzt.“
Unsere wichtigsten Ressourcen sind das
Know-how und Wissen der Menschen –
in die müssen wir investieren.
Michael Soder, Ökonom
Auch die Energiekosten sind weiterhin ein zentrales Thema. Der Strompreisdeckel ist ausgelaufen, die Elektrizitätsabgabe wurde wieder erhöht. Auch die Erneuerbaren-Förderpauschale und der Erneuerbaren-Förderbeitrag wurden wieder eingeführt, die zur Finanzierung des Ausbaus grüner Energien dienen. Die ÖGB-Ökonomin fordert eine gerechtere Aufteilung der steigenden Stromnetzkosten. Internationale Händler müssten stärker beteiligt werden, um die Mehrkosten für Haushalte zu reduzieren. Weiters solle die öffentliche Hand die Finanzierung des Netzausbaus über Garantien, Haftungen und Kredite stützen. Langfristig brauche es eine EU-weite Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis sowie einen effektiven Krisenmechanismus, also einen Preisdeckel für Strom, Gas und Wärme, um im Bedarfsfall leistbare Preise besser sicherstellen zu können. Aber auch Modelle für regulierte Tarife sollten laut Pfister diskutiert werden.
Privathaushalte am Kämpfen
Hamdi Hassan erlebt die Preisentwicklungen hautnah. Ihre monatlichen Stromkosten haben sich in den vergangenen drei Jahren verdreifacht – von 50 auf 150 Euro. „Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll“, sagt die ehemalige Radiojournalistin aus Somalia. Hassan arbeitet heute als Dolmetscherin und gelegentlich als Journalistin in Wien: „Ich habe eine Anstellung als Dolmetscherin, muss derzeit aber jeden zusätzlichen Auftrag annehmen, den ich bekommen kann.“ Die Arbeitstage seien lang, die Energiereserven am Abend oft aufgebraucht, sie fühle sich unter Dauerstress.
Auch die Bildungskosten ihrer Kinder bereiten ihr Sorgen: „Man sagt, Schule sei in Österreich gratis. Aber wir zahlen ständig: für Materialien, Ausflüge und Nachhilfe.“ Ein zusätzliches Grammatikbuch für 13 Euro oder 20 Euro für eine zusätzliche Nachhilfestunde: All das summiere sich. „Nächste Woche stehen zwei Ausflüge an, da braucht mein Kind 50 Euro. Auch wenn der Elternverein etwas zuschießt: Es ist eine ständige Belastung.“ Doch die Bildung ihrer Kinder sei Hassan ein zentrales Anliegen. Sie versuche dann, an anderer Stelle zu sparen.
Sparen für die Wirtschaft?
Das wird mit einem sogenannten Konsolidierungspaket in Österreich nun auch auf gesamtstaatlicher Ebene gemacht. Der im Mai präsentierte Budgetentwurf der Bundesregierung setzt aktuell in fast allen Lebensbereichen den Sparstift an. Vorgesehen sind unter anderem eine Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionist:innen, der Wegfall des Klimabonus, die Rücknahme der Inflationsanpassung von Sozialleistungen wie der Familienbeihilfe sowie Gebührenerhöhungen.
Doch Ökonomin Angela Pfister warnt: Sparen bringe die Wirtschaft nicht in Schwung. Auch internationale Organisationen wie die OECD raten in Rezessionszeiten von reinen Kürzungen bei den Ausgaben ab. „Es sind dringend Offensivmaßnahmen notwendig, um die Konjunktur zu beleben“, sagt Pfister. Besonders nötig seien Investitionen in Fachkräfteausbildung, sozialen Wohnbau, öffentlichen Verkehr, Elementarbildung und Pflege. Diese Ausgaben würden sich lohnen und kämen in der Zukunft in anderer Form zurück. So würden rund 70 Prozent der investierten Mittel bei Pflege, Gesundheit und Elementarbildung in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen in die öffentlichen Budgets zurückfließen.
Der Blick in die Zukunft
Die Zukunftsfrage stellt sich auch Benjamin Liedlbauer immer öfter. Nach seiner Lehre im BMW-Motorenwerk in Steyr wurde er dort als Elektrotechniker übernommen. Die vergangenen Jahre waren auch in seinem Unternehmen von Kurzarbeit, Lieferengpässen und einer unsicheren Auftragslage geprägt: „Wir wussten oft nicht, ob am nächsten Tag produziert wird“, sagt Liedlbauer. Sorgen mache ihm aktuell besonders die geopolitische Lage: „Die internationale Zollpolitik gibt mir zu denken, aber auch, dass nun überall wieder mehr Waffen produziert werden.“
Seit 2022 ist Liedlbauer zudem Bundesjugendvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE. „Junge Menschen fragen sich, ob ihre Arbeit noch zukunftssicher ist“, erzählt er. In seinem Betrieb sei die Vollautomatisierung bereits Standard. Dennoch brauche es menschliche Eingriffe und Wartung. „Man muss sich stets weiterbilden, um nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt der 24-Jährige. Im Austausch mit anderen jungen Menschen hört er angesichts der allgemeinen Teuerung auch immer öfter von Mehrfachjobs. „Einige Lehrlinge gehen tagsüber in die Lehre und kellnern nachts.“ Diese Entwicklungen finde er sehr beunruhigend.

Aktuell ist Liedlbauer in Bildungskarenz und absolviert die Werkmeisterschule. Dass die Bildungskarenz in ihrer ursprünglichen Form abgeschafft wird, bedauert er: „Viele Menschen können sich sonst kaum neben ihrem Vollzeitjob weiterbilden.“ Dabei wäre die Aus- und Weiterbildung in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je, auch als Jobgarant. Derzeit wird von der Bundesregierung zwar an einer Weiterbildungszeit als Nachfolgemodell gearbeitet, sie beinhaltet voraussichtlich aber höhere zeitliche und inhaltliche Anforderungen sowie stärkere Kontrollen.
Fortschrittliche Standortpolitik aus der Krise
Michael Soder, Wirtschaftsexperte bei der Arbeiterkammer Wien, sieht das Ganze ähnlich wie Liedlbauer. Neben den aktuellen konjunkturellen Herausforderungen stehe Österreich vor einem umfassenden Strukturwandel, der durch die Digitalisierung, die Klimakrise, aber auch geopolitische Verschiebungen vorangetrieben werde. Doch es fehle derzeit an einer klaren Entwicklungsrichtung für die Industrie und den Standort Österreich. „Eine zukunftsfitte Industriepolitik muss Fachkräftebedarf, Energiepreise, öffentliche Infrastruktur und Innovationskraft adressieren“, sagt Soder. Das Bildungs- und Forschungssystem sei dabei zentral: „Unsere wichtigsten Ressourcen sind das Know-how und Wissen der Menschen – in die müssen wir investieren.“
Von der frühen Bildung bis zur Hochschule brauche es eine Qualifizierungsoffensive – idealerweise in jenen Bereichen, die besonders zukunftsträchtig sind, wie Elektrotechnik, öffentlicher Verkehr oder Gebäudesanierung. Dabei sei auch immer das Prinzip der „Just Transition“ entscheidend, also ein sozial gerechter und fair gestalteter Übergang zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen Wirtschaft – insbesondere für die Menschen, deren Arbeitsplätze oder Lebensumstände von diesem Wandel direkt betroffen sind. Sie müssten mehr an Entscheidungsprozessen beteiligt werden und positive Folgen von Veränderungen glaubhaft aufgezeigt bekommen. Soder nennt als Beispiele: Gemeinden mit Windrädern, die ihren Strom günstiger beziehen könnten, oder Energiegemeinschaften, die überschüssigen Strom an energiearme Haushalte verteilen.
Eine zukunftsfitte Industriepolitik muss Fachkräftebedarf,
Energiepreise, öffentliche Infrastruktur und
Innovationskraft adressieren.
Michael Soder, Ökonom
Mutige industriepolitische Positionierung
Trotz allem blickt Soder optimistisch auf die kommenden Jahre – sofern heute die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Insbesondere in der Kreislaufwirtschaft und in den Umwelttechnologien habe sich Österreich bereits als vorbildlich hervorgetan. Die voestalpine sei etwa ein Vorzeigebetrieb, was die Dekarbonisierung betrifft. Das Unternehmen versuche, „grünen“ Stahl CO2-neutral herzustellen. Unter anderem werde dazu Stahlschrott verwendet, ein gutes Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Aber auch in anderen Zukunftsfeldern brauche man sich nicht zu verstecken. Im Gegenteil: In den Quantentechnologien sowie im Bereich der Bio and Life Sciences zähle Österreich zur Weltspitze. Und diese Bereiche seien auch künftig von Vorteil, da die neue industriepolitische Strategie der EU-Kommission genau diese Schwerpunktsetzungen für Europa vorsieht: Quanten, Weltraum, Material- und Produktforschung sowie Kreislaufwirtschaftstechnologien.
Österreich müsse sich nun industriepolitisch klar positionieren, Investitionen tätigen und Kooperationen stärken, um die bereits vorhandenen Standortvorteile tatsächlich nutzen zu können. Auch Angela Pfister sieht die Chance, auf rotweißroten Erfolgen weiter aufzubauen. Das duale Bildungssystem sowie die Sozialpartnerschaft zählt sie zu den wichtigen Faktoren, die die Wirtschaft Österreichs in der Zweiten Republik nachhaltig prägten.
Was sind die 🚧 Barrieren für erfolgreiche #Industriestrategien und wir stark wirken sie? @christaschlager.bsky.social hat gemeinsam mit mir einen Blick in die Literatur geworfen.
www.awblog.at/Wirtschaft/E…
— Michael Soder (@ecolomist.bsky.social) 30. April 2025 um 06:22
Die Finanzierungsfrage
Doch wie soll mit diesem Sparkurs nun in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur investiert werden? Pfister verweist auf die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen auf der Einnahmenseite – etwa durch eine Erhöhung der Körperschaftsteuer oder die Einführung einer Erbschaftsteuer auf große Vermögen. Eine Vermögensteuer ab einer Million Euro könnte laut Berechnungen der Arbeiterkammer bis zu zehn Milliarden Euro jährlich einbringen. Diese Mittel würden es ermöglichen, gezielt in zentrale Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu investieren – etwa in Bildung, Pflege, Kinderbetreuung, öffentliche Infrastruktur und leistbares Wohnen.
Wirtschaftliche Erholung ist dringend notwendig, doch sie darf kein abstraktes Zahlenspiel bleiben. Sie muss im Alltag von Menschen wie Hamdi Hassan oder Benjamin Liedlbauer spürbar sein – etwa im Kühlschrank, auf der Stromrechnung, in der Schule, bei der Wohnungssuche oder auf der Werkbank. Gerade jetzt hat Österreich die Chance, aus der Krise heraus eine echte Transformation zu schaffen. Das bedeutet: nicht länger zuschauen, sondern aktiv gestalten. Mit einem klaren Plan, gezielten Investitionen und auch einer großen Portion Mut, auch in herausfordernden Zeiten in die Zukunft zu investieren.
Info
In Krisenzeiten wird deutlich, wie wichtig ein starker Sozialstaat für den Erhalt des Lebensstandards vieler Menschen ist. Auf der Website www.sozialleistungen.at der AK Wien gibt es einen Überblick über alle Leistungen – und einen neuen Podcast zu Sozialpolitik mit dem Titel „In bester Gesellschaft – der Wissenschaftsdialog für die Vielen“.