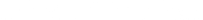Axel Honneth im Gespräch
Arbeit&Wirtschaft: Wenn wir von der Krise unserer Demokratie sprechen, von Politikverdrossenheit und Groll, kann man das nicht ohne Berücksichtigung von Arbeitsverhältnissen diskutieren. Sie äußern in Ihrem Buch Verblüffung darüber, dass man das vergessen hat. Was hat man vergessen, was man schon einmal wusste?
Axel Honneth: Die ältere sozialwissenschaftliche Tradition und die ältere sozialistische Tradition waren sich bewusst, dass die Arbeitsverhältnisse so beschaffen sein müssen, dass sich die Betroffenen – also die Beschäftigten – an der demokratischen, politischen Willensbildung angemessen beteiligen können. Da muss man nur an Georg Wilhelm Friedrich Hegel oder später an Émile Durkheim denken, denen war das ebenso bewusst wie der sozialistischen Tradition. Wie können die Arbeitsverhältnisse beschaffen sein, dass sie der Demokratie nicht entgegenstehen?
Was wäre dann angemessen? Dass man seiner Arbeit einen Sinn zuschreibt, dass man nicht kommandiert wird, sondern selbst etwas mitzureden hat? Wie definiert man das?
Angemessen wäre eine Art von Arbeitsverhältnis, das zunächst überhaupt erlaubt, mich an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Dazu gehören bestimmte materielle Verhältnisse. Wer unter Armut leidet, ist dazu weniger in der Lage als ein Reicher. Das ist ja unmittelbar einleuchtend. Die Arbeit muss auch so vergütet sein, dass man frei von Sorgen ist. Denn ebenso zentral ist, dass man nicht in Abhängigkeit von Dritten gerät, dass man etwa buckeln muss. Politische Teilnahme braucht Zeit, denken wir nur an die Informationsbeschaffung. Es braucht auch Zeit, mit anderen darüber zu diskutieren. Wir sollten aber auch psychische Voraussetzungen nicht übersehen: Meine Arbeit muss so anerkannt sein, dass ich Vertrauen darin habe, dass andere mein Wort für wichtig halten. Das ist ein sensibler, aber wichtiger Punkt.
Für mich ist die Frage: Ist die Arbeit demokratieverträglich, ist sie sogar in sich demokratisch organisiert?
Axel Honneth, Professor an der Columbia University in New York
Wer dauernd schlechtgemacht wird, wird entweder an Selbstwertgefühl verlieren oder verbittert, oder wahrscheinlich beides? Und trainiert sich das dann quasi an?
Ich glaube, wer nicht wertgeschätzt wird, wer fortwährend von oben herab behandelt wird, wird das kognitive Selbstvertrauen schwer entwickeln können, das eine Voraussetzung dafür ist, ohne Scham an der Willensbildung teilzunehmen. Arbeitsverhältnisse werden dann demokratieförderlich, wenn sie Mitbestimmung erlauben.
…früher wurde bekundet, dass es nicht so sein dürfe, dass die „Demokratie vor Werktoren haltmacht“.
Wichtig ist: Ich bin nicht einfach ‚der Untergebene‘, sondern mein Wort zählt. Repetitive Arbeit, die geistig oder intellektuell unterfordert, kann zu dem Gefühl führen, dass man die Wirklichkeit überhaupt nicht beeinflussen kann. Das alles sind einige der Gesichtspunkte, die man nicht ignorieren darf.
Marx sprach von „entfremdeter Arbeit“, sie halten diesen Begriff ja nicht für so fruchtbar. Warum?
Ich sage nicht, dass der Begriff völlig unbrauchbar ist. Es ist ein konzeptionelles Problem. Wir sollten nicht so sehr subjektive Gefühle der Einzelnen betrachten. Dass sich jemand in seiner Arbeit ‚entfremdet‘ und unglücklich fühlt, kann tausenderlei Gründe haben. Etwa: Man kommt nicht mit den Kollegen zurecht, oder hat das Gefühl, man habe den falschen Beruf ergriffen. Auch ich hatte diese Gefühle zeitweise in meinem sehr privilegierten Beruf als Professor. Das können wir doch nicht meinen, wenn wir von Entfremdung sprechen. Marx äußerte, dass eine Arbeit nicht entfremdet ist, wenn man mit anderen und für andere arbeitet, sich darin verwirklicht, wenn das Produkt der Arbeit zu einem gewissermaßen ‚zurückschaut‘. Ich denke, so starke Aussagen können wir uns heute nicht mehr zutrauen. Es gibt schlicht immens unterschiedliche Arten von Arbeit. Der Entfremdungsbegriff ist zu zufällig, zu schwammig. Für mich ist die Frage: Ist die Arbeit demokratieverträglich, ist sie sogar in sich demokratisch organisiert?
Es gibt auch so etwas wie die Werte der arbeitenden Klassen. Dass man gute Arbeit leisten will, dass man stolz auf die eigenen Fertigkeiten und Leistungen ist, dass die Arbeit und das eigene Können die Quelle der Identität und des Selbstbildes ist. Wie wichtig ist das, für das Gefühl, ein anerkannter Teil der Gesellschaft zu sein?
Gewiss, eine gute Organisation von Arbeit verlangt die Wertschätzung von Arbeit. Aber die Vorstellungen, die sie beschrieben, sind sehr stark an die industrielle Periode gekoppelt, und häufig auch mit harter, körperlicher Tätigkeit verbunden. Der typische Arbeitsstolz ist der Handwerkerstolz. Das ist gut nachvollziehbar. Für viele andere Tätigkeiten, etwa im Dienstleistungssektor, hat es solche Konzepte der Wertigkeit der Arbeit nicht gegeben. Darauf vergessen wir gern, dass ein riesiger Teil der Bevölkerung als Dienstmädchen beschäftigt war. Diese Arbeiten waren gering angesehen, am Ende lag kein Produkt vor. Der Lehrerberuf hat es geschafft, einen eigenen Berufsstolz zu entwickeln. Viele andere Berufsbilder haben das nie geschafft. Wir müssen über diese Wertigkeiten verschiedener Arbeiten nachdenken.
Was macht es mit einer Demokratie, wenn neoliberale Thinktanks die gesellschaftspolitische Diskussion beeinflussen? Viel, denn die Finanzierung dieser Thinktanks kommt vom Who's Who der österreichischen Industrie- und Finanzwelt.https://t.co/4b6rOx9g71 pic.twitter.com/vo3yfSdWI7
— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@AundWMagazin) January 23, 2023
Geschieht das nicht längst implizit? Wer eine Pflegedienstleistung erbringt, ist zu Recht stolz auf seine Arbeit. Wer als Verkäufer oder Verkäuferin im Handel arbeitet, ist möglicherweise stolz auf die zwischenmenschliche Dimension der eigenen Arbeit, dass man Kund:innen gut berät. Zugleich erleben wir, dass Beschäftigte in Berufen mit hohem Prestige und hohem Einkommen häufig empfinden, dass sie nur sinnloses Zeug machen, das eigentlich niemand braucht.
Das stimmt, aber Sie sagen selbst: Implizit. Wir haben so etwas wie Konflikte über die Wertigkeit mancher Berufe, aber keine explizite Debatte und kein tiefergehendes Nachdenken. Nach der Finanzkrise sank das Ansehen von Bankangestellten, während Corona stieg das Ansehen der Beschäftigten von Paketlieferdiensten. Ich bin mir sicher, in ganz vielen Familien wird über solche Fragen debattiert. Es wäre tatsächlich einmal interessant, zu erforschen, wie viele Menschen eigentlich über solche Fragen reden. Und ich bin mir sicher, sehr, sehr viele! Aber schauen Sie sich doch die Talkshows an: Ich habe noch keine gesehen, die über diese Fragen wirklich offen diskutierte.