„Medienzukunft, jetzt!“, hieß es in der ORF-Ankündigung 2022, als der neue multimediale Newsroom eingeweiht wurde. Im selben Jahr machte das US-amerikanische Softwareunternehmen OpenAI das Tool ChatGPT der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Schnell wurde auch dem letzten Schreiberling klar, dass die Zukunft der Medien stark von künstlicher Intelligenz geprägt sein würde. Sie hat sich seither als fester Bestandteil des Berufsalltags etabliert. Aber was bedeutet das für die Zukunft des Journalismus?
KI am Küniglberg
„Wir versuchen uns gerade im Voice Cloning“, erzählt Daniela Nemecek. „Damit könnten wir Nachrichten in gewissen Regionen automatisiert in anderen Sprachen und Dialekten ausgeben.“ Nemecek arbeitet beim größten Medienunternehmen Österreichs als Juristin. Die 41-Jährige ist Teil des ORF-Zentralbetriebsrats und beschäftigt sich intensiv mit Cybersecurity und KI. „Im Medienrecht begegnet uns KI oft im Zusammenhang mit Deepfakes und Identitätsmissbrauch oder wenn unsere Urheber- bzw. Markenrechte verletzt werden“, sagt sie. Die Redakteur:innen des ORF erreicht die künstliche Intelligenz vor allem über die betriebseigene Software AiDitor. Damit werden etwa Schlagzeilen und Texte für den Onlinebereich, für Social Media oder den Teletext generiert oder Audioaufnahmen verbessert. Ein Klick sorgt dafür, dass Hintergrundgeräusche eines auf der Straße aufgenommenen O-Tons verschwinden und Stimmen klarer verständlich werden.
„Der ORF muss seit dem Jahr 2000 mit immer weniger Budget auskommen, wir haben schon reduziert, was geht“, erklärt Nemecek und führt Arbeit&Wirtschaft durch den Newsroom. „In den kommenden zehn Jahren geht ein Drittel der Belegschaft in Pension. KI führt also nicht zu Einsparungen, sondern hilft uns, diese Entpersonalisierung zu stemmen.“ Die gesetzlich festgelegten Aufgaben des ORF würden schließlich nicht weniger werden. Im Betriebsrat gelte es allerdings wachsam zu sein, sagt Nemecek: Unterschätzen dürfe man etwa nicht den Mehraufwand, der anfallen könne. Von den Redakteur:innen werde mit zunehmender technologischer Unterstützung auch immer mehr Output erwartet.
📺 Der kulturMONTAG hat sich in der aktuellen Sendung umfassend mit den Herausforderungen von Journalismus & demokratischer Öffentlichkeit beschäftigt: Von Techbros über DSA zur österreichischen Medienpolitik. Mit dabei: Concordia-Generalsekretärin @danielakraus.bsky.social.
on.orf.at/video/142697…— Presseclub Concordia (@concordia.at) 1. April 2025 um 12:40
Gefahr KI?
Aber wenn die KI nun Texte ausgibt und auch Fragen beantwortet, wie sehr bedroht sie dann selbst Jobs im Mediensektor – einer Branche, die krisengebeutelt durchs digitale Zeitalter wandelt? Viele traditionelle Medien haben in den vergangenen Jahren Redakteur:innenstellen abgebaut oder Abgänge nicht nachbesetzt. Ende 2024 waren 956 Journalist:innen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitssuchend gemeldet oder befanden sich in Schulungen, wobei die Zahl etwa auch Fotoredakteur:innen, Schriftsteller:innen oder Social-Media-Manager:innen inkludiert.
„Bei rund 5.000 Personen, die hauptberuflich vom Journalismus leben, sind 956 Journalist:innen 19 Prozent“, sagte Lydia Ninz, Geschäftsführerin der Berufsberatung Ajour, kürzlich im Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“. „Anders gesagt: Einer von fünf ist ‚hockenstad‘. Das ist alarmierend.“ Vonseiten des AMS hieß es, die Zahl müsse im Rahmen des generellen Anstiegs der Arbeitslosigkeit betrachtet werden.
Dass vor allem Printmedien sich mit veritablen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert sehen, ist auch mit der Digitalisierung verknüpft. Multinationale digitale Plattformen ziehen immer mehr Werbeeinnahmen vom heimischen Markt ab. Google, Facebook und Co nahmen im Vorjahr 2,6 Milliarden Euro mit Werbung aus Österreich ein, was aus Hochrechnungen der seit 2020 eingehobenen Digitalsteuer und Werbeabgabe hervorgeht. Hinsichtlich Werbevolumen haben die Digitalriesen die österreichischen Medien, deren Geschäftsmodelle zum Großteil auch stark auf Inserate setzen, schon lange hinter sich gelassen. Die nahmen 2024 rund 2 Milliarden Euro ein, Tendenz fallend.
In diese Gemengelage hinein kommen nun immer mehr Technologien auf den Markt, die das Potenzial haben, menschliche Arbeit zu ersetzen – und damit Kosten zu sparen. KI-Avatare moderieren mancherorts bereits die Nachrichten, kürzlich wurde die erste Zeitung gelauncht, die ausschließlich von KI gestaltet wurde. Bei einer vierseitigen Beilage der italienischen Tageszeitung „Il Foglio“ stellten Journalist:innen zwar noch Fragen, Antworten und Texte lieferte aber die KI im Alleingang.
Digitales Know-how
„Viel mehr als Arbeitsplatzverluste fürchte ich den Verlust eines demokratischen Grundprinzips“, sagt Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, „denn eine von KI gemachte Zeitung ist ja kein Journalismus.“ Die demokratischen Kernaufgaben des Journalismus – also etwa Kontrolle der Machthabenden, kritische Hinterfragung, Einordnung von Geschehnissen – könnten von einer KI nicht erfüllt werden.
„Die Traumvision wäre, dass man als Journalist:in Arbeiten an KI-Programme auslagern kann und damit zukünftig mehr Ressourcen für die Recherche oder den Kontakt zu User:innen hat“, sagt Kraus. Sie merkt an, dass sich derzeit insbesondere die Aufgaben von Medienunternehmer:innen und Verlagen wandeln. „Die große Frage ist: Wie schafft man es heute, mit nach journalistischen Standards recherchierten Inhalten die Menschen zu erreichen? Das ändert sich gerade völlig.“
Weltweiter Vergleich
Im internationalen Vergleich werden traditionelle Nachrichtenkanäle wie Fernsehen, Radio und gedruckte Zeitungen in Österreich zwar häufiger genutzt als im globalen Mittel, doch Onlineangebote sind auf dem Vormarsch. Dem „Digital News Report 2024“ von Reuters und Universität Oxford kann man entnehmen, dass das Fernsehen mit rund 27 Prozent das beliebteste Informationsmedium der Republik bleibt, allerdings folgen auf Platz zwei schon die sozialen Medien. 15 Prozent der Befragten gaben an, Social Media als Hauptnachrichtenquelle zu nutzen, um 2 Prozent mehr als 2023. Hinsichtlich der Nutzung von KI zeigt sich eine Skepsis: Medienkonsument:innen fühlen sich deutlicher wohler, wenn ein Mensch den Hauptpart der Nachrichtenerstellung übernimmt und KI nur als Unterstützung nutzt. Und: Das generelle Vertrauen der Bevölkerung in Medien nimmt seit einigen Jahren kontinuierlich ab.
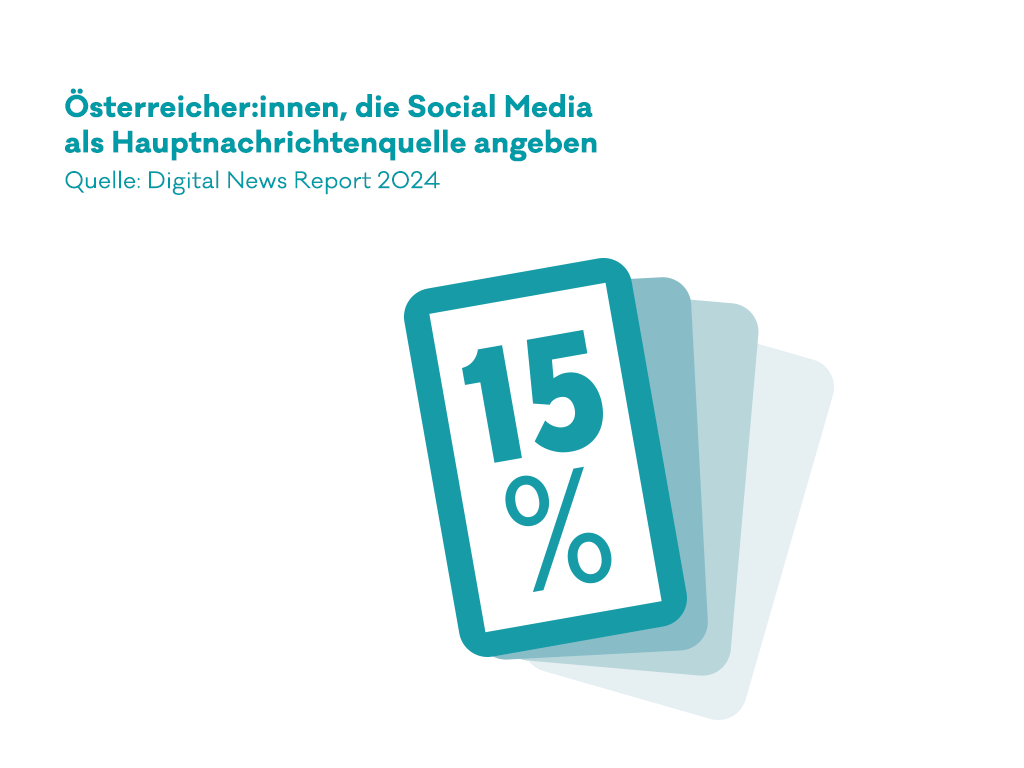
Generell müssten nach Kraus bei der Implementierung der KI-Technologien verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Die Medienkonsument:innen benötigen Transparenz und Sicherheit, zentrales Stichwort: Glaubwürdigkeit. Sie selbst müssten über eine entsprechende digitale Grundbildung verfügen.
„Woran es uns mangelt, ist medien- und journalismusbezogene Forschung, auch im Zusammenhang mit KI“, sagt Kraus. „Wo ist zum Beispiel der Lehrstuhl für Medienpolitik, der sich mit solchen Fragen beschäftigt?“ Von den 75 Millionen Euro, die die gesamte staatliche Medienförderung in Österreich etwa ausmacht, würden nur 50.000 Euro im Fördertopf für Forschung bereitstehen, „und das in einer Branche, die in einem extremen technologischen und gesellschaftlichen Umbruch ist!“ Das aktuelle Förderwesen würde das bestehende Mediensystem vielmehr stabilisieren als Innovation vorantreiben. Außerdem müssten Journalist:innen selbst vermehrt über künstliche Intelligenz berichten.
Verstehen, beteiligen, bewältigen
„Verstehen, beteiligen, bewältigen: Das sind die zentralen Stufen“, sagt Christoph Großkopf. Er meint damit, wie Redakteur:innen gut mit den smarten Technologien umgehen können. Der Außenpolitikredakteur von der Austria Presse Agentur (APA) ist Teil des Betriebsrats und engagiert sich in der Journalistengewerkschaft GPA als Digitalexperte des Präsidiums. Für ihn sei essenziell, dass Arbeitnehmer:innen im Mediensektor mit der Zeit gingen und sich weiterbilden, denn: „Viel wahrscheinlicher als große Arbeitsplatzverluste ist es, dass es zu einer Verschiebung kommt. Ein Teil wird von Maschinen übernommen, aber neue Aufgaben werden das Berufsbild erweitern“, sagt Großkopf.
Die österreichische Nachrichtenagentur in der Wiener Laimgrubengasse hat sich schon früh mit der technologischen Weiterentwicklung innerhalb der Medienbranche auseinandergesetzt. Die APA bietet den österreichischen Medienhäusern heute einerseits selbst Software-Lösungen an, andererseits nutzt die Belegschaft verschiedene KI-Tools im Betrieb. In der Redaktion selbst, beim geschriebenen Text, komme aber alles noch vom Menschen, betont Großkopf.
Der APA-Betriebsrat geht auf Basis aktueller Forschungsergebnisse nicht davon aus, dass „KI in den nächsten Jahren in der Lage sein wird, einen gesamtjournalistischen Prozess von Anfang bis Ende alleine auszuführen“. Bei der Implementierung und Entwicklung von KI im Medienbetrieb müsse verstärkt die Perspektive der Kolleg:innen, der Beschäftigten, hinzugezogen werden. “Dann werde ich es mit Journalist:innen zu tun haben, die mit dieser Technologie, mit der Symbiose zwischen Mensch und Maschine, mitwachsen.“ Und hier seien die Betriebsräte von Bedeutung. Sie seien das zentrale Bindeglied, um eine arbeitnehmer:innenfreundliche Nutzung von KI-Tools zu bewerkstelligen. Bei der APA sei dazu eine KI-Richtlinie entwickelt worden, die auch ethische Grundsätze enthält.

Mehr Zeit für Recherche?
Auch beim ORF gibt es seit Februar offizielle KI-Guidelines. Die 17-seitigen Richtlinien klären Grundlegendes zum KI-Einsatz sowie zum praktischen Umgang mit den entsprechenden Tools. KI-Anwendungen müssen beim ORF „gegenüber dem Publikum […] ausgeschildert werden, sofern es dadurch zu Missverständnissen über die Qualität der redaktionellen Arbeit kommen könnte“. Zudem wurde damit ein Ampelsystem etabliert. Das zeigt, wann Anwendungsfälle erlaubt sind (grün), einer Einzelfallentscheidung bedürfen (gelb) oder nicht erlaubt sind (rot).
Entwickelt wurde die Richtlinie vom Redaktionsrat des ORF. Medienrechtlerin und Betriebsrätin Nemecek sieht den Nutzen der Guidelines, betont aber, dass das als interne Regulierung beim Thema KI nicht ausreiche: „Da braucht es eine Betriebsvereinbarung, so wie bei anderen Themen, etwa dem Datenschutz. Auch in Kollektivverträge muss rein, dass es etwa immer einen Menschen geben muss, der entscheidet.“ Nemecek und das Team im Zentralbetriebsrat würden gerade an einer Betriebsvereinbarung arbeiten.
Woran es uns mangelt, ist medien- und
journalismusbezogene Forschung, auch im
Zusammenhang mit KI.
Daniela Kraus, Presseclub Concordia
Entlastung statt Ersatz
Dass der Mensch im Zentrum des Journalismus bleibt, ist auch für ORF-Redakteur Yilmaz Gülüm ein Knackpunkt. Er arbeitet seit acht Jahren beim TV-Magazin „Report“. 2024 deckte Gülüm mit einem Kollegen Missstände rund um eine „Mietmafia“ in Wien auf, die Geflüchtete ausbeutet. In der Praxis könne die KI laut Gülüm nur unterstützen und Redakteur:innen nicht so schnell verdrängen. „Besonders hinsichtlich der Kerntätigkeiten, also wo hinfahren und vor Ort recherchieren, Geschichten aufschnappen und mit Leuten sprechen“, sagt Gülüm. „Das werden wir auch in zehn Jahren noch so machen.“ Die KI könne auch dann nicht in der Lage sein, solche Aufgaben zu übernehmen und etwa Missstände aufzuzeigen.
Generell sieht der TV-Journalist zwei Blickwinkel auf das Thema. „Die positive Perspektive ist, dass durch weitgehende Automatisierungen viele simple Routineaufgaben wegfallen.“ Er denkt dabei – ähnlich wie Kraus vom Presseclub Concordia in ihrer „Traumvision“ – an Entlastung. „Dann hätten wir Journalist:innen mehr Ressourcen für ‚richtigen Journalismus‘, also dafür, Geschichten zu finden und Recherchen zu machen“, sagt Gülüm. Und was ist der zweite, negative Ausblick? „Dass frei werdende Ressourcen nicht journalistisch genutzt, sondern eingespart werden. Das läutet dann quasi einen ‚race to the bottom‘ ein.“
Gülüm sieht wie alle das wirtschaftliche Problem: „Wie soll Journalismus finanziert werden, wenn das der Markt nicht ausreichend schafft?“ Aber er glaube daran, dass die Gesellschaft aus Zeitpunkten wie jetzt lernt. Und den Wert von Journalismus auch in Zukunft erkennt. „Solange in der Bevölkerung ein Interesse besteht, richtig informiert zu werden, wird es Wege geben, diese Nachfrage abzudecken“, sagt er. „Die Hoffnung wäre, dass KI und Desinformation dieses Bedürfnis nach menschengemachtem Journalismus vielleicht sogar stärker machen.“ Nachsatz: „Ich bin im Kern optimistisch – das ist mein Naturell.“
Weiterführende Artikel
„Eine KI ist nie neutral – sie braucht den Menschen als Aufsicht“
Vom Buchdruck zur KI: Was uns die Geschichte über Medien lehrt
„Vergessen wir nicht, dass der Mensch nie in totaler Kontrolle seines Lebens ist“

