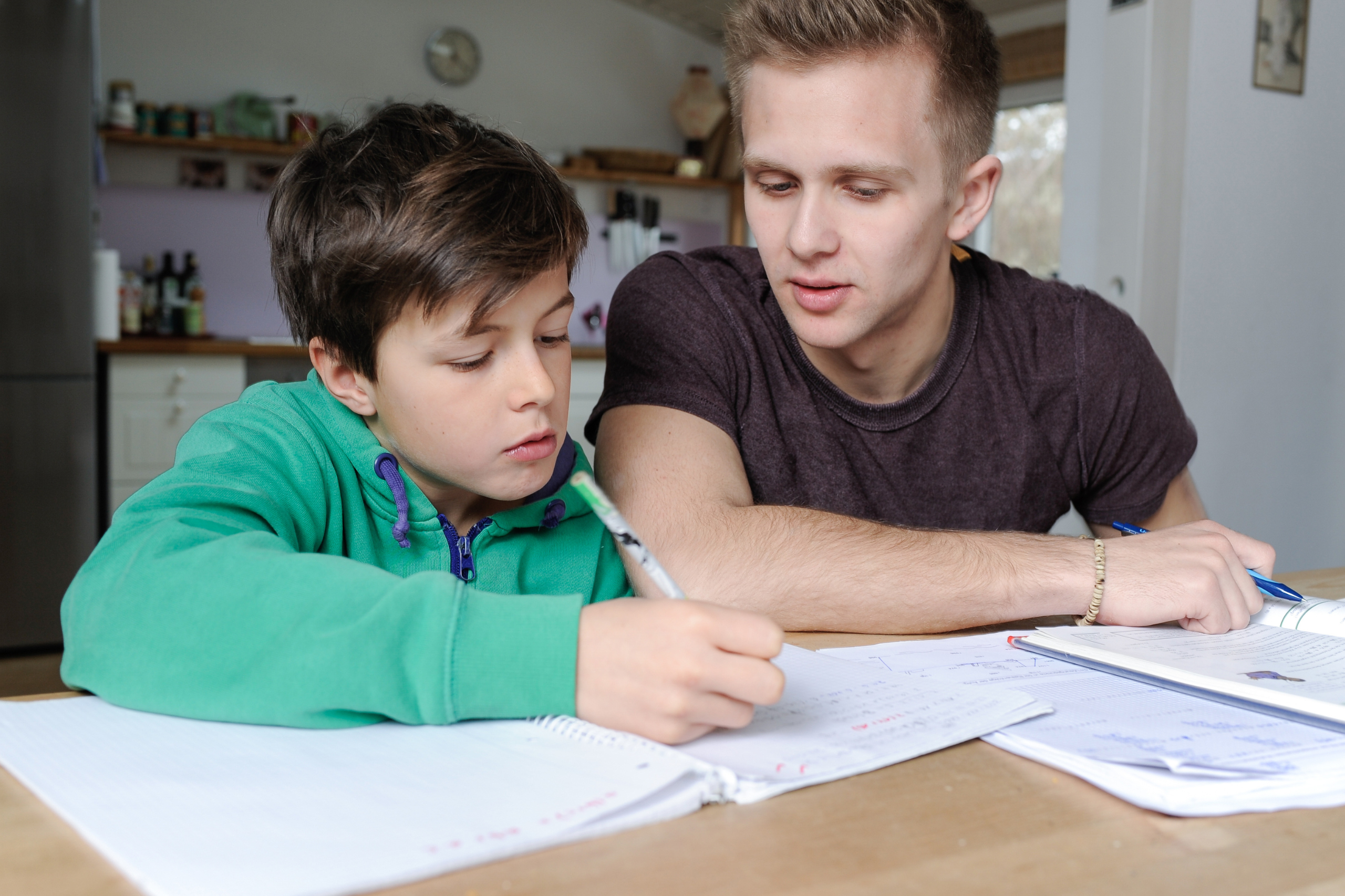Zerbombte Häuser in der Ukraine, hungernde Zivilbevölkerung im Gazastreifen, flüchtende Menschen im Sudan: Die Bilder aktueller Kriege sind allgegenwärtig. Sie prägen Schlagzeilen und diplomatische Gipfel – und, zynisch formuliert: Sie lassen auch die Kassen der Rüstungsindustrie klingeln. Wo Krisenherde nicht abklingen, steigt die Nachfrage nach Panzern, Drohnen und militärischen Fahrzeugen. Auch in Österreich, das sich gesetzlich zur Neutralität verpflichtet hat, ist das Thema Aufrüstung präsenter denn je, zumal auch die Europäische Union Milliarden für Verteidigung mobilisieren möchte. Im Frühjahr kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, bis zu 800 Milliarden Euro für Rüstungsinvestitionen bereitzustellen: als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine und wachsende Unsicherheit hinsichtlich der Sicherheitsgarantien der USA.
Während auf europäischer Ebene über Summen historischen Ausmaßes gesprochen wird, zog auch Österreich Konsequenzen: Die Bundesregierung beschloss 2022, im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine, ein Sonderbudget für das Bundesheer. Bis 2027 sollen die jährlichen Miniaturausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit auf rund fünf Milliarden Euro steigen. Im Vergleich zu NATO-Staaten, die die Fünf-Prozent-Marke anpeilen, wirkt das moderat. Für Österreich, wo die Ausgaben 2018 noch bei 0,6 Prozent lagen, ist es jedoch eine Zäsur. Jahrzehntelang galt das Bundesheer als Helfer bei Hochwasser und Blauhelm-Missionen, nicht als Symbol militärischer Stärke.
Rüstungsindustrie in Österreich
Von der allgemeinen Aufrüstung profitieren auch heimische Betriebe. Rund 150 Unternehmen sind in dem Bereich tätig und erwirtschaften rund 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das Geschäft ist kein Selbstläufer, da Betriebe, wenn sie in die Rüstungsbranche einsteigen wollen, strengere Standards erfüllen müssen als in der zivilen Industrie. Der österreichische Waffenhersteller Steyr Arms liefert Schusswaffen an das Bundesheer und weltweit an Militärs und Polizei. Der deutsche Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall baut in Österreich Lkws. Die einstige Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug produziert als Teil des US-Konzerns General Dynamics Radpanzer. Auch in den Werkshallen von Steyr Motors brummt die Produktion. Die Motoren aus Oberösterreich werden etwa in Schiffen und Mannschaftstransportern verbaut, Letztere dienen häufig militärischen Zwecken. „Der Rüstungsboom steht uns noch bevor“, heißt es von Unternehmensseite. Die dafür neu geschaffenen europäischen und internationalen Budgets würden in den nächsten Jahren für eine entsprechende Nachfrage sorgen.

Im ersten Halbjahr 2025 stieg die Belegschaft von 115 auf 135 Beschäftigte. Man profitiere von Fachkräften aus dem schwächelnden Automobil-Sektor, habe einen Auftragsbestand von über 300 Millionen Euro bis 2030 und könne den Output ohne großen zusätzlichen Investitionsaufwand durch weitere Schichten in etwa verdreifachen. Dem Unternehmen drohte 2018 die Insolvenz. Nach der Übernahme durch die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares, ein Restrukturierungsprogramm und Personalabbau verzeichnet das Unternehmen heute wieder ein deutliches Wachstum.
„Die Mitarbeiter:innen sind sehr froh, dass wir wieder in einer stabilen Lage sind“, berichtet Betriebsrat Martin Brandner. Besonders geschätzt wird die Vier-Tage-Woche, die seit 2019 in der Produktion praktiziert wird. Doch er gibt auch zu: „Natürlich ist ein gewisser Konflikt da, wenn man weiß, dass manche der eigenen Produkte im Krieg eingesetzt werden. Aber am Ende arbeiten wir hier, weil es ein sicherer und guter Job bei uns in der Region ist.“

Wirtschaftsfaktor Aufrüstung
Aber kann Aufrüstung generell ein Job- und Wirtschaftsmotor sein? Ökonomische Studien zeigen, dass Militärausgaben im Vergleich zu klassischen öffentlichen Investitionen geringere Multiplikatoreffekte entfalten. Das heißt, sie haben nur beschränkt weitere Ausgaben, Investitionen oder wirtschaftliche Aktivitäten zur Folge. Investitionen in Forschung etwa können Innovationen stärken, von denen wiederum die industrielle Entwicklung profitiert. Investitionen in den Schienenverkehr erleichtern unter anderem den Transport von Waren, was die Wirtschaftstätigkeit ankurbelt. Bei Panzern oder Munition hält sich dieser Effekt für die Gesamtwirtschaft in Grenzen.
Laut Goldman Sachs Research 2025 liegt der Multiplikator zusätzlicher EU-Verteidigungsausgaben bei 0,5 über zwei Jahre. Das heißt: Ein Euro an Militärausgaben erzeugt nur rund die Hälfte an zusätzlicher Wirtschaftsleistung. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft betont, dass die Wirkung entscheidend davon abhängt, wo und wie die zusätzlichen Rüstungsausgaben getätigt werden. Würde Europa seine Beschaffung stärker auf eigene Produktionsketten stützen und von Importen – etwa aus den USA – abrücken, könnte ein Ausgabenanstieg das europäische Wirtschaftswachstum erhöhen. Bleibt die aktuelle Importabhängigkeit jedoch bestehen, verpufft der konjunkturelle Effekt weitgehend.
Wir waren immer Teil der Friedensbewegung
und sprechen uns auch gegen eine Militarisierung und
eine Erhöhung der Rüstungsausgaben aus.
Martina Schneller, PRO-GE
Für Gewerkschaften ist die allgemeine Aufrüstung ein doppeltes Dilemma: Einerseits vertreten sie die Beschäftigten in einer Branche, die aktuell auf dem Gewinnpfad ist und sichere Jobs verspricht. Andererseits sind sie historisch Teil der Friedensbewegung. „Wir als Gewerkschaft werden uns auch immer im Interesse der Arbeitnehmer:innen für Frieden einsetzen. Kriege und militärische Konflikte verursachen menschliches Leid und entziehen den Arbeitnehmer:innen, die wir vertreten, die Existenzgrundlage“, sagt Martina Schneller, Leiterin der Internationalen Abteilung der PRO-GE. „Wir waren immer Teil der Friedensbewegung und sprechen uns auch gegen eine Militarisierung und eine Erhöhung der Rüstungsausgaben aus.“ Diese würden eher zulasten der dringend nötigen Investitionen zur Stärkung der industriellen Basis wie etwa in Stahl oder Elektronik gehen.
Neutrales Österreich
Gerade die österreichische Neutralität begünstige eine Positionierung als Standort für Peace Tech, das heißt für den Einsatz von neuen Technologien zur Verhinderung von Konflikten. Das könnten etwa Frühwarnsysteme sein, die mittels Datenanalyse und KI Gewaltpotenzial früh erkennen, oder Innovationen im Bereich Cybersicherheit. Zudem sehe man auch, dass der Rüstungswettlauf nicht unbedingt mehr Arbeitsplatze bringt. „Es kommt eher zu einer Verdichtung der Arbeit und zu mehr Überstunden“, sagt Schneller. Mehr Gewinn bedeute oft ganz einfach mehr Ausschüttung an die Aktionär:innen. Sascha Ernszt, PRO-GE Landesgeschäftsfuhrer von Wien, ergänzt: „Leider ist es auch noch immer gängige Praxis, über Leihfirmen Personal einzustellen, da sich Unternehmen den Recruiting-Prozess ersparen und ungeeignetes Personal unbürokratisch loswerden.“

Auf europäischer Ebene beobachtet Isabelle Barthes diese Entwicklung. Sie ist stellvertretende Generalsekretarin von industriAll Europe, dem europäischen Gewerkschaftsverband für Beschäftigte der Industrie. „Trotz aller politischen Ankündigungen sehen die Unternehmen bisher keinen großen Schub an Investitionen. Was wir sehen, sind mehr Schichten, mehr Leiharbeit, mehr Druck – aber keine nachhaltigen Strukturen.“
Wenn Aufrüstung Sozialfonds frisst
Hinzu kommt die Sorge, dass die Finanzierung der Aufrüstung andere Bereiche verdrängt. Schon jetzt fließen EU-Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds sowie aus der Aufbau- und Resilienzfaszilität, die seit 2020 Investitionen in die grüne und digitale Transformation fördern soll, in Verteidigung. Wenn für Panzer Milliarden „gefunden“ werden, während Schulen und Spitaler um Mittel kämpfen, wird das Vertrauen der Bevölkerung auf eine harte Probe gestellt. „Wir sehen in vielen Ländern, dass Verteidigungsausgaben mit Kürzungen an anderer Stelle gegenfinanziert werden“, sagt Isabelle Barthes. In Belgien etwa habe die Regierung Budgetkürzungen angekündigt, einen Tag nachdem sie sich beim NATO-Gipfel zu 5 Prozent Verteidigungsausgaben bekannt habe. „Das erzeugt massiven Unmut, gefährdet das Vertrauen in die Politik und trägt auch zum Erstarken der extremen Rechten bei“, warnt sie.
Das neue @aundwmagazin.bsky.social ist brutal! Brutal global. Weil, crazy Welt und so.
Und sie ist speziell: Wir haben 1 soft relaunch vollgezogen! 👉 www.arbeit-wirtschaft.at
Dieses Mal u.a. dabei: Ein großes Interview mit
@markusmarterbauer.bsky.social. @bundespraesident.at
haben wir…— Richard Solder (@richardsolder.bsky.social) 17. September 2025 um 09:29
Flexibilisierung der Arbeitsstandards
Zudem stehen aktuell arbeitsrechtliche Standards auf dem Spiel. Mit dem „Defence Industrial Readiness Act“ will die EU-Kommission Genehmigungen und Beschaffungen im Verteidigungsbereich beschleunigen, auch durch Änderungen im Umwelt- und Chemikalienrecht.
Die Rede ist von „gezielter Flexibilität“. Gewerkschaften warnen jedoch vor einer schleichenden Aushöhlung von Arbeitnehmer:innenrechten. Besonders die geplante Flexibilisierung der Arbeitszeitrichtlinie stößt auf Kritik. „Wir müssen aufpassen, dass es durch das Narrativ der Militarisierung nicht zu einem Abbau der Sozialrechte kommt“, warnt Martina Schneller von der PRO-GE. Sie betont auch die soziale Dimension von Sicherheit. Diese dürfe nicht allein in Militärbudgets gemessen werden. Sie bedeute auch, Zugang zu Gesundheitsversorgung zu haben oder einer Arbeit nachzugehen, die nicht krank macht.
Österreich steht hier nun wie viele andere Lander vor einem Balanceakt. Milliarden fliesen in Rüstung, während Investitionen in Schulen, Kinderbetreuung oder Klimainfrastruktur stocken. Der Rüstungsboom wird Arbeitsplatze sichern, offen bleibt, wie viele er schaffen kann, die langfristig bestehen. Er wird die Industrie vielleicht stabilisieren, aber nicht transformieren. Und er wird Budgets binden, die an anderer Stelle fehlen. Schneller erinnert an das historische Prinzip, dass Weltfrieden nur auf dem Boden sozialer Gerechtigkeit begründet werden kann. So stand es 1919 bereits im Versailler Vertrag zur Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation. Und dies scheint heute angesichts steigender Militärausgaben, wachsender sozialer Ungleichheit und ungelöster globaler Krisen aktueller denn je.