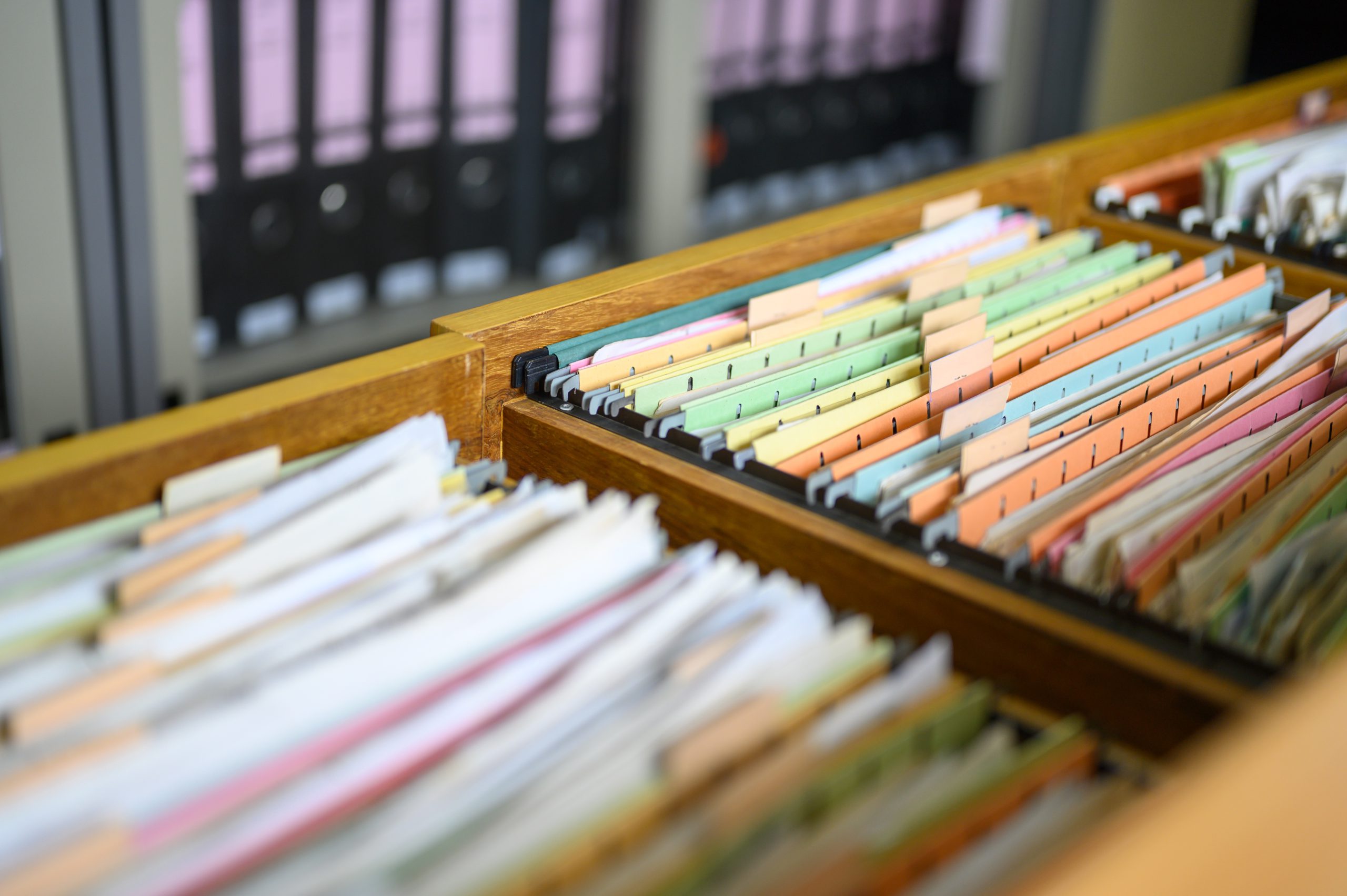Die Abgabenquote taucht derzeit immer wieder in der wirtschaftspolitischen Debatte auf: Finanzminister Markus Marterbauer „schnalzt […] die Steuer- und Abgabenquote auf ein Rekordniveau“, formuliert es die „Kronen Zeitung“ im Mai polemisch in einem Kommentar. Auch Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO argumentierte im Arbeit&Wirtschaft-Interview, die Abgabenquote in Österreich sei zu hoch. Gewerkschaften und Arbeiterkammer widersprechen und betonen, dass Steuern und Abgaben notwendig für unseren Sozialstaat seien.
Frau Schultheiß, hat Österreich also keine zu hohe Abgabenquote?
Jana Schultheiß: Nein. Die Debatte wird von verschiedenen Seiten angestoßen, auch von unternehmensnahen Parteien und Verbänden. Da wird dann der Ruf nach Steuer- und Abgabensenkungen im Sinne von Unternehmen laut und dabei geht es letztlich um einen Abbau des Sozialstaats.
In Österreich fließen rund zwei Drittel der Staatsausgaben in den Sozialbereich. Das betrifft zentrale Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung oder Pensionen – also Themen, die für uns alle wichtig sind. Wenn wir über Kürzungen reden, dann reden wir darüber, dass in diesen Bereichen die Leistungen gekürzt oder privatisiert werden. Für viele Arbeitnehmer:innen wäre das am Ende des Tages also eine zusätzliche Belastung.
Es geht also um den Sozialstaat.
Wenn wir über eine Senkung der Abgabenquote reden, dann reden wir – zumindest in Zeiten zu hoher Defizite – immer über Einschnitte beim Sozialstaat. Österreich verfügt über eines der besten Sozialsysteme der Welt. Wer es erhalten möchte, muss über seine Finanzierung reden. Diese Diskussion wird auch in Zukunft notwendig sein. Denn wir stehen vor großen Herausforderungen wie etwa dem demografischen Wandel oder der Klimakrise.

Wie ist die Abgabenquote Österreichs im internationalen Vergleich zu bewerten?
Es stimmt: Die Abgabenquote ist in Österreich auf den ersten Blick vergleichsweise hoch, mit über 40 Prozent. Im OECD- und EU-Vergleich liegt Österreich auf einem ähnlichen Niveau wie Frankreich, Belgien und skandinavische Staaten. In diesen Ländern steht die hohe Abgabenquote für ein hohes Wohlstandsniveau. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt.
Und zwar?
Die Steuerabteilung der AK hat die Abgabenquote im internationalen Vergleich untersucht und zeigt auf, dass internationale Vergleichsdaten oft fehlinterpretiert werden. Ein Beispiel ist die Schweiz: Dort liegt die Abgabenquote bei unter 30 Prozent. Das große Aber: Erwerbstätige müssen sich dort verpflichtend privat versichern. Das betrifft die Pensions- und Krankenversicherung, die damit nicht in der Statistik der Steuer- und Abgabenquote aufscheinen. Berücksichtigt man den Beitrag für die privaten Versicherungen, dann steigt die durchschnittliche Abgabenquote in der Schweiz von 27 auf 43 Prozent, während sie in Österreich praktisch gleich bleibt. Damit liegen beide auf einem nahezu gleichen Niveau. Ein ähnliches Bild zeigt sich in anderen EU-Ländern.
Ist der Fokus auf die Abgabenquote und den vermeintlich „zu teuren Staat“ auch eine Strategie von konservativer Seite, um von Vermögensteuern abzulenken?
Ja, diese Strategie ist durchaus erkennbar. Einerseits wird damit die Debatte rund um Vermögensteuern in den Hintergrund gedrängt, andererseits bereitet man so weitere Steuersenkungen für Unternehmen vor. Was wäre, wenn man auf die vollzogenen Steuer- und Abgabensenkungen der letzten Legislaturperiode, wie etwa die Absenkung der Körperschaftsteuer, verzichtet hätte? Wir hätten jetzt circa 15 oder 16 Milliarden Euro mehr Einnahmen! Das Budgetproblem wäre gelöst. Solche Zusammenhänge kommen medial zu wenig vor.
Bei der Frage, wie wir die Schulden abbauen,
geht es um Gerechtigkeit:
Krisengewinner:innen müssen sich mehr an diesen Anstrengungen beteiligen.
Jana Schultheiß, AK Wien
Stichwort Budgetanalyse: Sie fordern gemeinsam mit anderen AK-Expert:innen mehr vermögensbezogene Steuern für ein ausgeglichenes Budget. Geht es sich sonst nicht aus?
Es geht gar nicht um ein ausgeglichenes Budget. Es ist sinnvoll, dass gerade der Vermögensaufbau des Staates, also insbesondere die Investitionen in Schulen, Spitäler, Öffis etc., weiter über Schulden finanziert werden kann. Unser Ziel ist kein Nulldefizit. Aber das Defizit ist in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen, Stichwort Zinszahlungen. Bei der Frage, wie wir die Schulden abbauen, geht es um Gerechtigkeit: Krisengewinner:innen müssen sich mehr an diesen Anstrengungen beteiligen. Von den Konsolidierungsmaßnahmen werden grob gesagt 70 Prozent über die Ausgabenseite geregelt und nur 30 über die Einnahmenseite. Aus Sicht der AK braucht es eine ausgewogenere Strategie, die die Arbeitnehmer:innen nicht überproportional belastet.
Was ist mit vermögensbezogenen Steuern gemeint?
Vermögensbezogene Steuern umfassen nicht nur Vermögen- und Erbschaftsteuern, sondern auch Steuern wie Grunderwerb-, Grund- oder Kapitalverkehrsteuern. Im Rahmen des Doppelbudgets wurden bereits einige kleinere Änderungen vorgenommen, aber es sind noch immer viel zu wenige. Insgesamt sollte nicht nur über die Höhe der Abgabenquote, sondern auch über ihre Zusammensetzung geredet werden: 80 Prozent der Steuern kommen in Österreich von Löhnen und Konsum, nicht einmal 2 Prozent von vermögensbezogenen Steuern – also derzeit vor allem die Grund- sowie die Grunderwerbsteuer, potenziell aber auch Erbschaft-, Vermögen- und weitere Vermögensübertragungssteuern.
Sie argumentieren, dass der Anteil „sozial kaum verträglicher“ Sparmaßnahmen der Bundesregierung zu groß sei. Was muss sich noch ändern?
Ausgabenkürzungen wirken sich unter anderem negativ auf die Konjunktur, Verteilung und Beschäftigung aus und beinträchtigen auch die Gleichstellung von Frauen und Männern. Sparmaßnahmen treffen Frauen im Durchschnitt stärker als Männer. Das Gender Budgeting stellt ein sehr gutes Instrument dar, mit dem Auswirkungen von Maßnahmen auf die Gleichstellung geprüft werden können. Es wäre enorm wichtig, solche Prüfungen künftig stärker durchzuführen. Uns fehlen zudem Beschäftigungsimpulse, etwa durch Maßnahmen für Qualifizierung, Weiterbildung oder in der Arbeitsmarktpolitik.
Wie geht es in der Budgetdebatte jetzt weiter?
Viele der derzeitigen Zielvorgaben im Budget müssen jetzt noch in konkrete Maßnahme gegossen werden. Parallel dazu wird der österreichische Stabilitätspakt neu verhandelt.
Heute mal in diesem Format 😊. Unser doppelter Blick auf das #Doppelbudget:
— Jana Schultheiß (@janaschultheiss.bsky.social) 16. Juni 2025 um 11:02
Also jenes innerstaatliche Abkommen, das die Einhaltung der EU-Vorgaben zur Haushaltsdisziplin für Bund, Länder und Gemeinden regelt. Es wird jetzt umso wichtiger wegen des EU-Defizitverfahrens.
Genau. Dazu muss man wissen, dass die Defizitvorgaben der EU gesamtstaatlich gelten. Aus diesem Grund taucht auch die Diskussion um die Sozialversicherung gerade auf. Dieses Jahr wird verhandelt, wieviel Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen zur Budgetkonsolidierung beitragen müssen.
Man denkt bei Budgetdebatten oft nur an den Bund …
Ja, wenn man es runterbricht, hat der Gesamtstaat 2026 Ausgaben von rund 300 Milliarden Euro, auf den Bund fallen davon rund 95 Milliarden. Der Rest betrifft eben Gemeinden, Länder oder die Sozialversicherungen sowie einige ausgegliederte Einheiten wie die Universitäten oder wesentliche Teile der ÖBB.
Die Wirtschaftsprognose des WIFO ist optimistischer als bisher. Wird der Plan von Finanzminister Markus Marterbauer helfen, für stabilere und bessere Zeiten zu sorgen?
Jein. Marterbauers Doppelbudgets ist ein Konsolidierungsbudget, das die Staatsfinanzen stabilisieren soll, aber nicht für bessere Zeiten sorgen kann. Dafür bräuchte es mehr Geld. Aber ja, eine Stabilisierung kann in Kombination mit sinkenden Zinssätzen und dem deutschen Investitionspaket, das auch unserer Wirtschaft zugutekommen sollte, wieder bessere Zeiten ermöglichen. Auf der anderen Seite sind es unsichere Zeiten aufgrund internationaler Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die Energiepreise. Aber bleiben wir zuversichtlich.