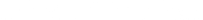Diese Studierenden hatten 2019 im Monat durchschnittlich 1.216 Euro zur Verfügung (wobei der Mittelwert bei 1.059 Euro liegt) und zahlen 440 Euro fürs Wohnen (wobei diese Kosten seit 2015 um 14 Prozent gestiegen sind). Mit 541 Euro fließt der größte Teil des Monatsbudgets aus der eigenen Erwerbstätigkeit. 65 Prozent der Studierenden arbeiten „nebenbei“, im Schnitt 20,4 Stunden. Auf dieses Einkommen sind drei Viertel unbedingt angewiesen. Doch die flexiblen, geringfügigen Jobs, in denen die Hälfte beschäftigt ist, fallen in der Krise als erstes weg. Für den Rest der Bevölkerung gibt es die Kurzarbeit, auch 140.000 Jugendliche nahmen diese in Anspruch. Aber was gibt es für erwerbstätige Studierende?
65 Prozent der Studierenden arbeiten „nebenbei“, im Schnitt 20,4 Stunden. Auf dieses Einkommen sind drei Viertel unbedingt angewiesen.
[infogram id=“aandw-online-erwerbstatigkeit-studierende-1h9j6q3lj5352gz?live“]Bleiben die Studierenden auf der Strecke?
Ein erstes Linderungsmittel sollte die Proklamierung eines „neutralen Semesters“ seitens des Bildungsministeriums sein. „Doch dieses hat sich nur auf Empfänger*innen der Studienbeihilfe bezogen“, wie Felix Schmidtner vom Referat für Bildung und Politik der ÖH Wien anmerkt. Wenn es um finanzielle Schwierigkeiten geht, so ist für dreißig Prozent der Studierenden das Wegfallen der Familienbeihilfe der Hauptauslöser. Genau so wenig hilft es zurück in die Erwerbstätigkeit. Einzig der psychische Druck, unter ungewohnten Bedingungen das Studium fortführen zu müssen, wurde dadurch gelindert.
Am 27. Oktober wurde bekannt, dass die Studienberechtigung künftig erlöschen soll, wenn man nicht zumindest 16 ECTS im jährlich schafft, was einem Arbeitsaufwand von etwa 400 Stunden entspricht. Will man zwei Studiengänge kombinieren oder verhaut man eine größere Prüfung, ist diese Anforderung schnell verfehlt. Es sind Ankündigen wie diese, auf die sich die Medienberichterstattung der letzten Monate konzentriert. Auch die ÖH tritt primär mit Koalitionsbrüchen und internen Konflikten in Erscheinung, die Wahlbeteiligung bei den Hochschüler*innenschafts-Wahlen lag 2019 bei nur 25,82 Prozent.
Eine Umfrage von Peter Hajek im Auftrag des Bildungsministeriums ergab im April dieses Jahres, dass zwanzig Prozent aller erwerbstätigen Studierenden ihren Job durch Corona verloren haben. Die durchschnittliche Arbeitszeit sank dadurch von 17,3 auf 11,4 Stunden – 34 Prozent sind deswegen in finanziellen Schwierigkeiten. Darunter leidet auch der Studienerfolg. Jede*r Fünfte konnte die geplanten ECTS im Sommersemester nicht erreichen. Das Studium verzögert sich, der Einstieg in das Arbeitsleben rückt weiter nach hinten, noch ein weiteres Semester muss finanziert werden. Die ÖH versprach deswegen einen Härtefonds, der unbürokratische und schnelle Einmalzahlungen bieten sollte. Besondere Härtefälle erhielten so einen Zuschuss von maximal 1.000 Euro. Einen solchen Antrag darauf stellte auch Lukas*.
Dreh ich die Heizung auf oder reicht die Wärmflasche?
Lukas ist 21 und studiert Rechtswissenschaften. Das Einkommen seiner getrennt lebenden Eltern ist gering, er lebt von rund 200 Euro Familienbeihilfe, dazu 182 Euro Studienbeihilfe und geringfügigen Nebenjobs, zuletzt als Ordner bei Fußballspielen. Der Stundenlohn beträgt etwas über neun Euro. Dass Fußballspiele fast ausschließlich am Wochenende oder abends stattfinden, macht diesen Job gut vereinbar mit einem Vollzeitstudium.
Am 10. März dann der Lockdown, der Spielbetrieb wird eingestellt. Im April sucht er deswegen einen neuen Job, geringfügig, Teilzeit, Praktikum, irgendetwas. Er schreibt über vierzig Bewerbungen und erhält ebenso viele Absagen. Selbst in Branchen wie dem Einzelhandel, der zu diesem Zeitpunkt auf Grundwehrdiener zurückgreifen muss. Im dritten Semester Jus an der Universität Wien kostet die Pflichtliteratur knappe 300 Euro. Immerhin kann er die Bücher nach bestandener Prüfung mit wenig Verlust weiterverkaufen. Markierungen darf er deswegen keinen machen, das senkt den Wert. Die Wohnung ist alt und unsaniert, „man heizt quasi zum Fenster raus“, erzählt er. Oft fragte er sich an kalten Frühlingstagen deswegen: „Dreh ich die Heizung auf oder reicht die Wärmflasche?“
Geringfügig Beschäftigte fallen dadurch aus den Arbeitslosigkeitsstatistiken raus. Es hat vor allem diejenigen getroffen, die unter zehn Stunden pro Woche arbeiten.
Felix Schmidtner, ÖH Uni Wien
Geringfügig Beschäftigte, deren Job wegfällt, unterliegen nicht der Arbeitslosenversicherung. „Die fallen dadurch aus den Arbeitslosigkeitsstatistiken raus“, erklärt Felix Schmidtner von der ÖH. Auch die ÖH habe nicht die nötigen Mittel, um alle Lohnausfälle zu kompensieren. „Es hat vor allem diejenigen getroffen, die unter zehn Stunden pro Woche arbeiten.“ Das sind immerhin 44 Prozent der arbeitenden Studierenden.
Gestiegen ist auch der Pflegeaufwand, wenn ein solcher gegenüber älteren Angehörigen oder eigenen Kindern besteht. Immerhin 7,5 Prozent der Studierenden haben ein eigenes Kind, zwölf Prozent davon sind gar alleinerziehend. Laut Felix Schmidtner trifft es auch Drittstaatsangehörige besonders schwer: „Die haben in der Regel doppelte Studienbeiträge zu zahlen, dazu kommt noch die oftmals fehlende Beschäftigungsbewilligung“. Als Student*in eines nicht-EU-Landes darf man laut Ausländerbeschäftigungsgesetz maximal zehn Stunden in der Woche arbeiten. Zusätzlich braucht es eben jene Beschäftigungsbewilligung, um die der Arbeitgeber beim AMS ansuchen muss.
Damokles‘ Lehre
Auch wenn 43 Prozent der Vollzeitarbeitenden und 39 Prozent der Teilzeitarbeitenden unter den Studierenden weniger Lehrveranstaltungen abschließen konnten, hatte das Distance-Learning an sich einige positive Effekte. Der durchschnittliche Studierende wohnt eine halbe Stunde vom Studienort entfernt, diese Wegzeit spart man sich. Da die Einheiten zudem aufgezeichnet abrufbar waren, konnten diese besser in den Arbeitsalltag integriert werden. Davon profitierten auch Studierende mit Pflegeverpflichtungen. Trotzdem leidet unter anderem die Konzentration unter der heimeligen Arbeitsumgebung, auch der Zeitaufwand ist gestiegen und es gab häufig Beschwerden über unklare Prüfungsmodalitäten. Wieder anderen wurde es erst durch die Fernlehre möglich, das Studium fortzusetzen.
Irina zum Beispiel war fast ein Jahr ans Bett gefesselt. POTS ist eine chronische, wenig erforschte Kreislauferkrankung und machte der 25-jährigen Südtirolerin das Verlassen des Hauses nur mit Rollstuhl möglich. Mittlerweile hat sich ihr Zustand gebessert, doch häufig gibt es Tage, an denen gar nichts geht. Alle fünf Wochen kriegt sie Infusionen mit Antikörpern von Plasmaspendern. An ein Vollzeit Präsenz-Studium oder gar einen Nebenjob wäre deswegen auf keinen Fall zu denken. Die Fernlehre öffnet hier unverhoffte Möglichkeiten. Da alle Seminare und Prüfungen online abgehalten werden, kann sie zumindest eines ihrer beiden Studien weiterführen. „Ich bin sehr froh darüber, ansonsten hätte ich vermutlich ein teures Fernstudium machen müssen.“ Wie es weitergehen könnte, wenn wieder vermehrt auf Präsenzunterricht gesetzt werden kann, weiß sie nicht.
„Trotz hoher Zufriedenheit kein Grund zum Feiern“
Über die Ergebnisse einer neueren Studierendenbefragung im September informierte die ÖH Uni Wien am 29. Oktober in einer Pressekonferenz. Alles in allem war die Zufriedenheit mit der digitalen Lehre immer noch überraschend hoch. Trotzdem sei dieser Aspekt alleine „kein Grund zum Feiern“, wie stellvertretende ÖH-Vorsitzende der Uni Wien, Hannah Lea Weingartner, urteilte. Große Unzufriedenheit gab es immer noch bei der Zeit für Prüfungen und den kurzfristigen Abgabefristen.
Nur 14 Prozent blickten positiv auf das kommende Semester.
Magdalena Taxenbacher, Referentin für Bildung und Politik, ÖH Uni Wien
„Manche Professoren stellten die Unterlagen für das ganze Semester erst zwei Wochen vor der Prüfung zur Verfügung“, berichtetet ein Teilnehmer der Umfrage. „Nur 14 Prozent blickten positiv auf das kommende Semester“, merkt Politik-Referentin Magdalena Taxenbacher an. Das ergibt sich nicht alleine aus dem gestiegenen Aufwand, sondern auch der fehlende Kontakt zu Kommilitonen und finanzielle Sorgen machen Studierenden zu schaffen. „Der Anteil derjenigen, die arbeiten, ist um 10,5 Prozent gesunken“, berichtet Felix Schmidtner, der für die Befragung verantwortlich war.
Auch nach der Pandemie „muss es noch mehr digitales Angebot geben“, fordert Weingartner. Oftmals beklagt wurde auch ein „Generalverdacht des Schummelns“, der seitens des Lehrpersonals bei Online-Prüfungen gestellt werde. Mit der Kamera davor das Zimmer abzufilmen verletze aber klar die Privatsphäre. Zur Vorbereitung auf Prüfungen laden manche Lehrende lediglich Texte hoch, andere halten digitale Meetings über Plattformen wie Moodle Collabroate ab.
Es braucht Krisenfonds, es braucht Gelder. Es kann nicht sein, dass Großkonzerne Millionen-, Milliarden an Förderungen bekommen und Studierende dastehen und im schlimmsten Fall ihre Miete nicht zahlen können, weil sie aus allen Schutznetzen irgendwie rausfallen und sich niemand für sie zuständig fühlt.
Hannah Lea Weingartner, stellvertretende ÖH-Vorsitzende Uni Wien
„Es braucht irgendeinen Standard, um sicherzustellen, dass Studierende gut lernen können“, so die ÖH. Außerdem wird auch eine Form der sozialen Absicherung seitens der Regierung gefordert: „Es braucht Krisenfonds, es braucht Gelder. Es kann nicht sein, dass Großkonzerne Millionen-, Milliarden an Förderungen bekommen und Studierende dastehen und im schlimmsten Fall ihre Miete nicht zahlen können, weil sie aus allen Schutznetzen irgendwie rausfallen und sich niemand für sie zuständig fühlt“, sagt Weingartner.