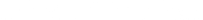Robert Misik: Angenommen, wir hätten im Spätsommer die Gesundheitskrise aufgrund der Impfungen überstanden. Können wir dann relativ schnell in eine ökonomische Normalität kommen?
Christoph Badelt: Die Wirtschaftskrise hat ihre Ursache darin, dass man Teilen der Wirtschaft aus Gründen der Pandemiebekämpfung verbietet zu arbeiten. Wenn das nicht mehr geschieht, wird es meiner Meinung nach rasch zu einem recht kräftigen Aufschwung kommen.
Manche Sektoren werden sich sicher langsamer erholen – man denke da an die Stadthotellerie oder das Kongressgeschäft – aber es wird auch einen großen Nachholbedarf der Menschen geben. Sie wollen endlich wieder reisen oder zu Veranstaltungen gehen. Wir wissen aber auch aus der Erfahrung vergangener Krisen, dass der Abbau der Arbeitslosigkeit langsamer vorankommt.
Das Gespräch im Arbeit&Wirtschaft Podcast
Im Moment sind knapp 400.000 Menschen arbeitslos, dazu kommen rund 70.000 in Schulungen des AMS. Aber viele Beobachter*innen rechnen mit einer Insolvenzwelle. Was, wenn das Schlimmste erst vor uns liegt?
Im Moment werden Insolvenzen künstlich vermieden, wegen Stundungen durch die Sozialversicherung und die Finanzämter. Ich denke schon, dass zusätzliche Arbeitslosigkeit entstehen wird, wenn das nicht mehr der Fall ist. Da werden kleine Unternehmen mit kleinen Belegschaften bedroht sein, etwa in der Gastronomie. Es ist aber zu hoffen, dass dann auch schnell neue Unternehmen entstehen.
Sollte man überlegen, Unternehmen, die jetzt von Insolvenz bedroht sind, zu retten? Die können meist nichts dafür, das waren ja vor der Krise gesunde Unternehmen.
Die Idee einer stärkeren staatlichen Beteiligung für eine befristete Zeit halte ich nach wie vor für diskussionswürdig. Zweifelsohne gäbe es dann knifflige Probleme im Detail, aber die Sozialpartner könnten die sicher lösen.
Es wird einen großen Nachholbedarf der Menschen geben. Sie wollen endlich wieder reisen oder zu Veranstaltungen gehen.
Christoph Badelt, WIFO
Das Beste für künftige Prosperität sind bekanntlich kluge Investitionen, weil sich die langfristig rechnen – und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Das wäre ja jetzt genau der Zeitpunkt dafür.
Ganz sicher. Denn wenn der Staat jetzt selbst Investitionen für wichtige gesellschaftliche Ziele ankurbelt oder plant, etwa im Klimabereich, im Verkehr, bei der Altbausanierung, bei der Dekarbonisierung, bei der Digitalisierung, dann hat das eben einerseits längerfristigen Nutzen und andererseits Einflüsse auf die Konjunktur.
Also Begrünung der Städte, Kühlung der Plätze, ein Sonnenkraftwerk auf jedes Dach …
Die Sanierung des Altbaubestandes ist ein gutes Beispiel. Hier kann man nicht nur den Energieverbrauch einschränken, das sind dann genau die Bereiche, in denen die Klein- und Mittelbetriebe und kleine Handwerksbetriebe zum Zug kommen, wo dann also in diesem Sektor Arbeitsplätze entstehen. Das hat viel mehr Wirkungen, als wenn man irgendwo ein Hochhaus hinbaut.
Der Installateur als High-Tech-Betrieb …
Ist er längst! Man denke an Heizungstechnik, an Photovoltaik und all diese Dinge. Das wird durch den Staat durch Subventionen gefördert. Aber man muss natürlich auch an die Investitionen denken, die die öffentliche Hand selbst vorantreibt, etwa im Verkehrswesen.
Generell gefragt: Ist diese krasse Unterscheidung zwischen investiven und konsumtiven Ausgaben für den Staat, für eine Volkswirtschaft als Ganzes, wirklich sinnvoll? Ist Pflege nur konsumtiv, ist Breitband dagegen investiv? Und Nachfrage mobilisiert ja auch Investitionen.
Wenn man Investitionen sehr eng definiert, dann sind Ausgaben für die Pflege keine Investition, wohl aber die technische Ausstattung, die Sie in der Pflege benutzen. Aber wir wissen alle, dass es auch so etwas wie eine soziale Infrastruktur gibt und soziale Dienstleistungen, die entweder von der öffentlichen Hand bereitgestellt oder finanziert werden. Die haben vielleicht nicht unbedingt eine Produktionsfunktion für den materiellen Wohlstand im Sinne von materiellen Gütern, sind aber wesentlich für eine Gesellschaft, die Wohlfahrt und auch das wirtschaftliche Klima. Man denke da nur an die Jugendsozialarbeit.
… und die ist dann vielleicht sogar direkt „investiv“ hinsichtlich künftiger Berufsbiografien.
Man braucht sich da nur die Frage stellen: Was passiert, wenn nichts passiert? Das ist „konsumtiv“, aber es ist auch „investiv“, also die Übergänge sind fließend. Ganz abgesehen davon, dass das auch Investitionen in die Stabilität unserer Demokratie sind.

Zugleich sind das aber jene Sektoren, wo jene „systemrelevanten“ Arbeitnehmer*innen arbeiten, denen wir vom Balkon applaudieren …
Wenn wir uns fragen, wie wertvoll diese Arbeit gesellschaftlich ist, dann kommen wir schnell zu dem Schluss, dass die Bezahlung mit dieser Wertschätzung eigentlich nicht übereinstimmt. Nur: Wer legt genau fest, was der gesellschaftliche Wert ist? Zugleich werden diese Arbeitnehmer*innen fast immer direkt oder indirekt vom Staat bezahlt, und der Staat ist auch deshalb nicht der Großzügigste, weil Steuern zu zahlen nicht sehr populär ist. Aber ich bin überzeugt, dass es massive Verschiebungen zugunsten dieser Berufsgruppen geben wird.
Viele Menschen sind jetzt arbeitslos geworden und erhalten das vergleichsweise knausrige österreichische Arbeitslosengeld, also eine Nettoersatzrate von 55 Prozent. Die verfügbaren Einkommen der Österreicherinnen und Österreicher sind in der Krise noch stärker zurückgegangen als in vergleichbaren Ländern, nicht nur Deutschland, sogar im Vergleich mit den USA. Da lief doch was krass schief.
Es wäre ökonomisch sinnvoll, Menschen mit einem sehr niedrigen Einkommen mehr zu geben, als das geschehen ist. Einfach, weil wir im Moment eine sehr große Konsumzurückhaltung erleben.
Der Vergleich mit den USA hinkt etwas, da dort das Ausgangsniveau von Sozialleistungen äußerst niedrig war. Aber in einem haben Sie recht: Es wäre ökonomisch sinnvoll, Menschen mit einem sehr niedrigen Einkommen mehr zu geben, als das geschehen ist. Einfach, weil wir im Moment eine sehr große Konsumzurückhaltung erleben. Wir haben Sparquoten, die verrückt hoch sind. Sehr viele Menschen haben eigentlich genug Geld, geben es aber nicht aus, vor allem aus Vorsichtsgründen.
Ein spannender Punkt: Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Aber sehr viele Menschen haben gar nicht an Einkommen verloren, haben aber viel weniger ausgegeben. Wie verteilt sich das Ihrer Meinung nach?
Alle, die im Zuge der COVID-Krise arbeitslos geworden sind, haben erheblich an Einkommen verloren, dazu jene, die in Kurzarbeit waren. Darüber hinaus wird es schon verdammt schwer, das zu quantifizieren: Viele kleine Selbstständige, die Ein-Personen-Unternehmen, da hat es viele Leute sehr hart getroffen. Das ist eine Gruppe, auf die wir viel zu wenig schauen.
Wir haben in ersten Studien gesehen, dass es einerseits besonders viele hart getroffen hat, die es vorher schon sehr schwer hatten, dass aber auch unter den untersten Einkommensbeziehern gar nicht so wenige sind, die sogar etwas dazugewonnen haben – etwa Pensionisten oder Langzeitarbeitslose, die durch Einmalzahlungen oder Ähnliches ein bisschen was draufbekommen haben. Wer eine normale Pension bekommt, beispielsweise, der ist wirtschaftlich ganz gut durch diese Krise gekommen – was die psychische Situation anlangt, kann das schon wieder ganz anders aussehen.
… und normale Angestellte, die nicht in Kurzarbeit waren, sondern ihr übliches Einkommen bezogen, die haben womöglich einen höheren Kontostand, weil sie weniger ausgeben konnten.
Offen gesagt: Wir haben viel anekdotische Evidenz, aber das Gesamtbild ist noch nicht exakt klar.
Die Europäische Union hat glücklicherweise bisher ganz anders reagiert als in der letzten Krise: nicht mit Spar- und Austeritätspolitik, sondern mit Solidarität und Hilfsprogrammen. 750 Milliarden sollen allein für Hilfen und Kredite investiert werden. Komischerweise gibt es in anderen Ländern eine heftige Diskussion, wie dieses Geld am sinnvollsten verwendet werden kann, etwa in Italien …
Ja, da ist sogar die Regierung zerbrochen an dieser Frage …
Gut, da geht es auch um insgesamt 200 Milliarden Euro, nimmt man die Hilfen und Kredite zusammen, aber auch Österreich könnte rund drei Milliarden Euro bekommen. Merkwürdigerweise gibt es da null Diskussion.
Ich denke, es ist auch mit der EU-Kommission noch nicht ausdiskutiert, ob dieses Geld nicht für Investitionen genützt werden kann, die ohnehin schon geplant waren, also etwa für die Klimaziele im Regierungsprogramm.
Wenn wir diese Krise also hinter uns haben, dann haben wir einen Staatsschuldenstand von 100 Prozent des BIP …
Jedenfalls glaube ich nicht, dass sich der Finanzminister graue Haare wachsen lassen muss ob des Schuldenstandes.
Nein, eher im oberen Achtziger-Bereich, also so 85 oder 87 Prozent, in dieser Größenordnung. Jedenfalls glaube ich nicht, dass sich der Finanzminister graue Haare wachsen lassen muss ob des Schuldenstandes.
Wenn Sie sagen, jede Krise der vergangenen Jahrzehnte hat eine höhere Sockelarbeitslosigkeit hinterlassen als die davor: Was tun gegen das Gespenst von „Jobless Growth“, aber auch gegen eine Situation, in der immens viele Menschen Angst haben, austauschbar zu sein, davor, den Job zu verlieren?
Das ist eines der ganz großen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen unserer Zeit. Wir hatten das ja schon vor der Krise: Zwar wuchs die Beschäftigung, aber neu in den Arbeitsmarkt traten einerseits Migrant*innen ein und andererseits Frauen, deren Erwerbsbeteiligung ja erfreulicherweise wächst. Die Zahl der Arbeitslosen blieb hoch. Jemand, der sagt, er habe dafür die vollständige Lösung, der ist unehrlich. Aber eines ist klar, ein Schlüssel dafür ist Bildung, Bildung und noch mal Bildung! Und zwar in allen Lebensphasen, das fängt im Kindergarten an, mit dem Spracherwerb, bei Kindern, die wenig Unterstützung von ihren Eltern haben, die dann viel zu früh am Abstellgleis landen. Das ist nicht nur ein sozialer Skandal, sondern auch ein wirtschaftlicher. Und das geht dann weiter, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man so tut, als wären 50-Jährige zu alt für Weiterbildung.