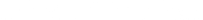Faktum ist: Die Besitzungen sind hierzulande in den Händen von wenigen konzentriert.
Die Frage, wem eigentlich Grund und Boden in Österreich gehört, ist aufgrund der Intransparenz nicht einfach zu beantworten. Die größten GrundeigentümerInnen werden nirgendwo offiziell veröffentlicht. Das Grundbuch gibt zwar über einzelne Grundstücke Auskunft. Und auch die Wirtschaftsberichte in den Medien sind aufschlussreich dahingehend, welche internationalen Investoren inzwischen ehemals österreichische Immobilienfirmen besitzen, ein Beispiel ist das einstige Wohnungsunternehmen BUWOG. Faktum ist: Die Besitzungen sind hierzulande in den Händen von wenigen konzentriert.
Größter Waldbesitzer
Der mit Abstand größte Grundeigentümer des Landes sind die Bundesforste mit 850.000 Hektar (entspricht zehn Prozent der Staatsfläche). Die Stadt Wien folgt mit etwa 58.000 Hektar. Danach kommen Adelsfamilien und Klöster: Die größten kirchlichen Eigentümer sind das steirische Benediktinerstift Admont, die Chorherren von Klosterneuburg, das Prämonstratenserstift Schlägl sowie die Klöster von Göttweig, Kremsmünster, Heiligenkreuz und Melk. Weite Teile der österreichischen Wälder, Wiesen und Äcker befinden sich in adeligen Händen, insbesondere der Esterházy (44.000 Hektar), Mayr-Melnhof-Saurau (32.400 Hektar) und Liechtenstein (25.000 Hektar), aber auch der Schwarzenberg (20.000 Hektar), Habsburg, Coburg & Gotha, Starhemberg und Schaumburg-Lippe.
In Österreich sind 82 Prozent des Waldes in Privatbesitz, nur in Portugal ist noch mehr Wald privatisiert.
In Österreich sind 82 Prozent des Waldes in Privatbesitz, nur in Portugal ist noch mehr Wald privatisiert. Der EU-Durchschnitt liegt bei 52 Prozent. Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst in Österreich 2,73 Millionen Hektar – und sie wird sukzessive weniger. 1999 waren es noch 3,3 Millionen Hektar Agrarflächen. Hochgerechnet werden somit 22 Hektar pro Tag verbaut – das entspricht einer Fläche von mehr als 30 Fußballfeldern. Österreich gehört damit europaweit zu den Ländern mit dem größten Rückgang an landwirtschaftlichen Flächen. Der agrarische Bodenmarkt ist spätestens seit der Finanzkrise 2008/09 bei Anlegern stark umkämpft. Das treibt die Preise für Ackerland weiter in die Höhe, bereits jetzt ist Österreich im europäischen Vergleich ein Hochpreisland.
Welche Auswirkungen die Besitzverhältnisse auf die Bodenpreise haben, ist schwer zu sagen. Denn bei beiden herrscht Intransparenz, wie der Ökonom Thomas Ritt betont, der die Abteilung Kommunalpolitik der Arbeiterkammer (AK) Wien leitet. Die Konzentration ist jedenfalls bemerkenswert.
Welche Auswirkungen die Besitzverhältnisse auf die Bodenpreise haben, ist schwer zu sagen.
Die Hochpreispolitik für Grundstücke, Häuser und Wohnungen gilt selbstredend auch und gerade für Wien. Die Finanzierung von Baugrund für den sozialen Wohnbau werde zunehmend schwierig, unterstreicht Ritt. „Deshalb nimmt der Anteil der privaten Bauleistung am gesamten Wohnbausegment deutlich zu. Das bedeutet steigende Mieten, kleinere Wohnungsgrößen, mehr teure Eigentumswohnungen und mehr Wohnungen als Anlageobjekte.“ Diese bezeichnet Ritt im Interview sehr haptisch als „betonierte Sparbücher“. Die Rede ist von sogenannten „Vorsorgewohnungen“ – aufgrund der zu erwartenden Rendite. Es bestehe der Verdacht, dass speziell in Neubauten der Leerstand an Wohnungen sehr hoch ist, schätzt der Ökonom. Aufmerksamen BeobachterInnen bestätigt sich dieser Eindruck auch am Stadtrand, wo heute mitunter leer stehende Wohnanlagen frühere Einfamilienhäuser ersetzen. Eine Folge ist: Es fehlt der Boden zum Bauen von leistbaren Wohnungen in ausreichendem Ausmaß.
Ein Schwimmbad am Dach eines Hauses mit geförderten Mietwohnungen? Der von der Wiener Architektenlegende Harry Glück geplante Wohnpark Alterlaa im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing gilt als Vorzeigeprojekt der funktionierenden Satellitenstadt der 1970er-Jahre. Heute wird Wiens Kompetenz in Sachen sozialer Wohnbau selbst in deutschen Großstädten wie Berlin oder München bewundert. Ein Vorteil ist, dass die österreichische Bundeshauptstadt „vorausschauende Wohnpolitik“ macht, unterstreicht Ökonom Ritt. Von den rund 850.000 Wohnungen gehören 50 Prozent gemeinnützigen Bauträgern und 220.000 der Gemeinde. Dennoch hat Wien damit zu kämpfen, dass der geförderte Wohnbau mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten kann.
Wien hat damit zu kämpfen, dass der geförderte Wohnbau mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten kann.
„Im Vergleich zum massiven Bevölkerungswachstum wird zu wenig gefördert und damit auch leistbar gebaut. Um den Wiener Wohnungsmarkt in sein altes soziales Gleichgewicht zu bringen, braucht es für ungefähr ein Drittel des Bevölkerungszuwachses geförderte Neubauwohnungen“, so Ritt. „Über ein paar Jahre hinweg betrachtet, sind das mindestens 9.000 leistbare Wohnungen pro Jahr. Davon sind wir weit entfernt.“ Laut seinen Angaben kostet der Grund in schlechter städtischer Lage rund 600 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. In städtischen Gunstlagen, beispielsweise beim neuen Hauptbahnhof, werden Spitzenpreise von bis zu 2.000 Euro verlangt, für die absolute Spitzenlage mittlerweile sogar 4.000 Euro. Das Limit des sozialen Wohnbaus sind aber 300 Euro, so der Experte. „Derzeit werden irre Preise bezahlt. Alle wollen anlegen.“ So werde der soziale Wohnbau verdrängt.
Sich etwas trauen
Wie ist dem Einhalt zu gebieten? „Man muss sich etwas trauen“, sagt Thomas Ritt. Bei einer vergleichbaren Problematik ist das ausgerechnet in den konservativen Bundesländern Westösterreichs geschehen. Um der Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben, haben Vorarlberg und Tirol ihre Bauordnung novelliert. Wird, vereinfacht gesagt, eine Wiese in einen Baugrund umgewidmet und damit preislich aufgewertet, muss binnen zehn Jahren gebaut werden, andernfalls tritt die Widmung außer Kraft. Diese „Vorbehaltsflächen“ müssen der Gemeinde oder einem Bauträger, der geförderte Wohnbauten errichtet, zum Kauf angeboten werden – und dürfen nur nach Bedarf eingerichtet werden; das erfordert besonderes Augenmerk auf die Baulandbilanzen der Gemeinde. Diese Maßnahme wurde von Kritikern freilich als „kommunistisch“ verunglimpft.
Um der Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben, haben Vorarlberg und Tirol ihre Bauordnung novelliert.
Ein Spezialproblem ist im kleinen Vorarlberg der Fruchtsaftgigant Rauch. Nicht nur weil von dem ÖVP-nahen Imperium insgesamt eine viertel Million Euro in den vergangenen zwei Jahren als Spenden an die Bundespartei flossen, sondern auch aufgrund seines gesteigerten Kaufinteresses an Boden, was die Umwidmung geschützter Grünflächen notwendig machen würde. Das hat wiederum Bürgerinitiativen auf den Plan gerufen wie beispielsweise die „Bodenfreiheit“, ein Verein zur Erhaltung von Freiräumen in Vorarlberg. Im November soll dort die höchstwahrscheinlich fortgesetzte ÖVP-Grünen-Koalition über die Bodenbegehrlichkeiten des Rauch-Imperiums entscheiden.
Angesichts der aktuellen Bodenpreise stoße in der Bundeshauptstadt das Instrument der Bodenbevorratung an seine Grenzen, erläutert Ritt. Das habe Wien lange Zeit mit gutem Erfolg betrieben, indem der Wohnfonds geeignete Liegenschaften – sprich: mit Anschluss etwa an das öffentliche Verkehrs- oder das Kanalnetz – ankaufte und damit Flächen für den sozialen Wohnbau sicherte. Auch habe sich die Einführung der Widmungskategorie „förderbarer Wohnraum“ in die Wiener Bauordnung als untauglicher Versuch erwiesen, Bauland für leistbares Wohnen zu beschaffen. Dagegen gab es denn auch eine Klage der Interessenvertretung der HauseigentümerInnen. Die eher zahnlose Vorgabe wurde in der Novelle der Wiener Bauordnung (seit Ende März 2019 in Kraft) durch die Kategorie „geförderter Wohnbau“ ersetzt. Mit der neuen Bauordnung möchte Wien außerdem das Vermieten geförderter Wohnungen für touristische Zwecke – mit deutlich höheren Mieteinnahmen – vor allem durch Online-Anbieter wie Airbnb unterbinden. „Vielleicht können wir im Flachland“, hofft Ökonom Ritt, „mit ein bisschen Mut doch etwas von den ‚Alpinkommunisten‘ lernen.“
Heike Hausensteiner
Freie Journalistin
Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 9/19.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
heike.hausensteiner@gmail.com
oder an die Redaktion
aw@oegb.at