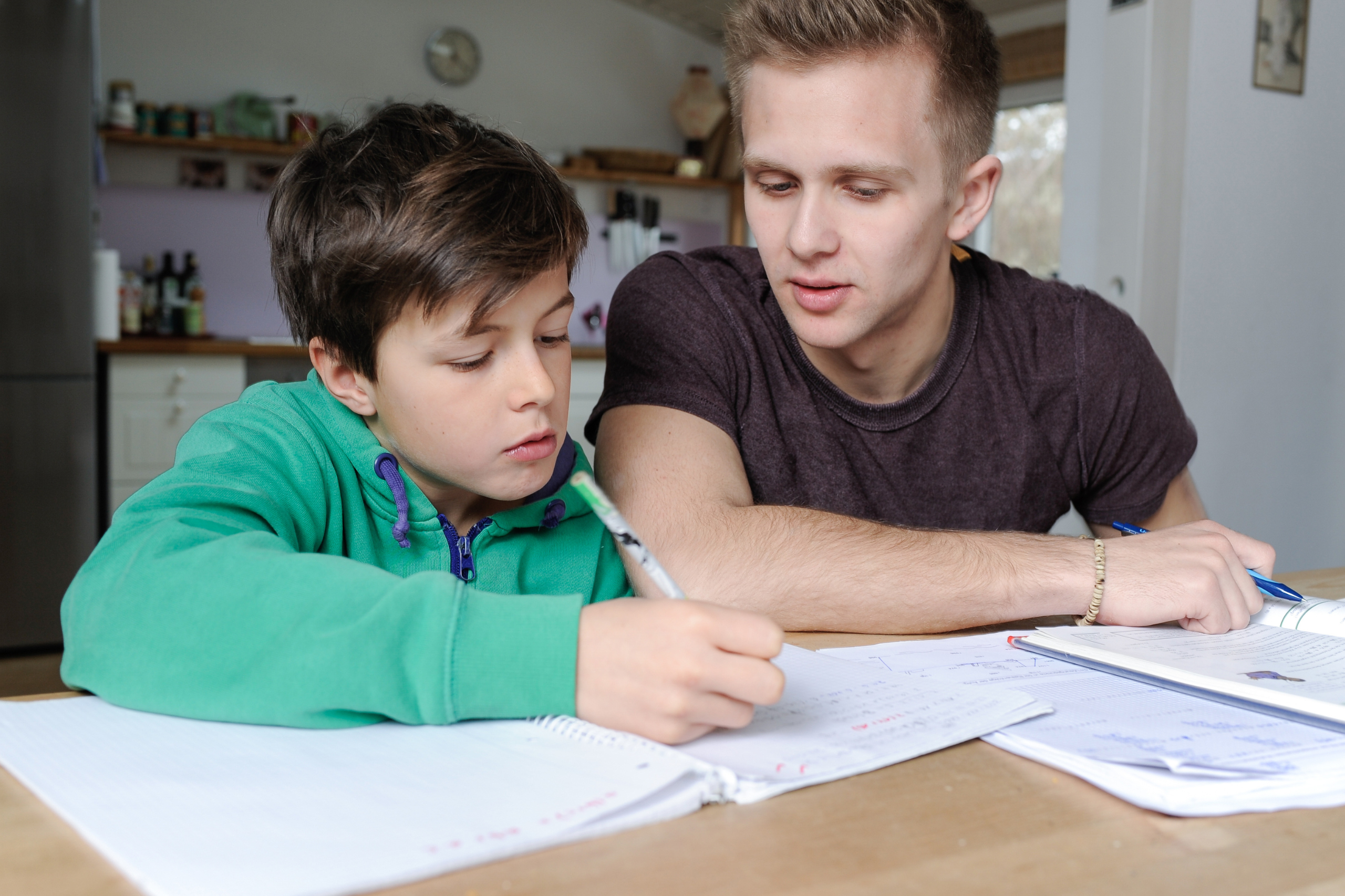Für die österreichische Bevölkerung ist er der neue sozialdemokratische Finanzminister. Für das Team von Arbeit&Wirtschaft ist er zudem der ehemalige Chefökonom der Arbeiterkammer, der das Magazin als Experte und zeitweise auch als Herausgeber prägte. Für die in schwarzen Anzügen gekleideten Securitys im Finanzministerium ist er schlicht „der Chef“. Markus Marterbauer ist seit einem halben Jahr Teil der österreichischen Bundesregierung. Im Sommer sprach er mit A&W über Finanzpolitik in einer dynamischen Welt und über ein Europa, das vor allem die eigene Souveränität und Widerstandsfähigkeit priorisieren sollte.
Arbeit&Wirtschaft: Herr Marterbauer, Sie sind ein Quereinsteiger in die Bundespolitik. Wie hat sich ihr Leben seit dem Regierungsantritt verändert?
Markus Marterbauer: Völlig – in den verschiedensten Dimensionen.
Inwiefern?
Zum einen ist man in der Politik viel mehr getaktet. Ich habe kaum noch Zeit zu schreiben. Das Einzige, was ich in den vergangenen Monaten geschrieben habe, war meine Budgetrede. Früher habe ich zwei bis drei Texte im Monat verfasst. Mein Vorteil ist, dass ich mich als Finanzminister mit Themen beschäftige, mit denen ich auch in der Vergangenheit befasst war – Budget, Steuern, Wirtschaftsentwicklung, internationale Fragen. In dem Sinn tue ich mir etwas leichter, meine Expertenrolle weiterzuspielen.
Sie haben im Sommer die Debatte um staatliche Eingriffe in die Lebensmittelpreise angestoßen, um die Inflation zu bekämpfen. Von welchen Ländern können wir hier lernen und was?
Von Österreich! Beim letzten Energiepreisschock – der Erdölkrise der 1970er-Jahre – waren wir eines der Länder mit sehr niedriger Inflationsrate. Im jetzigen Energiepreisschock, der Gaskrise, haben wir eine der höchsten. Natürlich hat sich die Welt in den vergangenen 50 Jahren weitergedreht, aber damals hat man sehr stark in Preise eingegriffen – und zwar indem die Sozialpartner reguliert haben, über den Preis-Unterausschuss der Paritätischen Kommission. Ich sage nicht, dass man das heute exakt genauso machen könnte wie damals, aber Länder, die versucht haben, in der Teuerungskrise in Preise einzugreifen, sind besser durch die Krise gekommen als Österreich.
Unser Problem ist, dass das Nicht-in-den-Griff-Bekommen
der Inflationsrate in den vergangenen Jahren
auch eine der wichtigsten Ursachen für das hohe Budgetdefizit ist,
das wir abzuarbeiten haben.
Markus Marterbauer, Finanzminister
Zum Beispiel?
Spanien etwa, mit verschiedenen Maßnahmen wie Eingriffen in die Energiepreise. Bei den Lebensmittelpreisen wurde über die Steuerpolitik gelenkt und Ähnliches. Spanien ist auch in Hinblick auf das Budget besser durch die Krise gekommen, und damit ist der unmittelbare Konnex zum Finanzministerium da. Unser Problem ist, dass das Nicht-in-den-Griff-Bekommen der Inflationsrate in den vergangenen Jahren auch eine der wichtigsten Ursachen für das hohe Budgetdefizit ist, das wir abzuarbeiten haben. Das wirtschaftspolitische Versagen der vorigen schwarz-grünen Regierung äußert sich auch darin. Wir müssen die Scherben aufkehren, das Budget sanieren und gleichzeitig versuchen, eine makroökonomisch bessere Politik zu machen.
In der EU wird Rüstung als Wirtschaftsmotor gehandelt. Wie stehen Sie dazu?
Um die Wirtschaft zu fördern, muss man nicht mehr in Verteidigung investieren. Da investiert man besser in den Ausbau der Mobilitätsnetze, bessere Energieinfrastruktur, mehr Pflegeversorgung, mehr Qualifizierung – das hat bessere ökonomische Effekte. Dennoch ist es unter den jetzigen geopolitischen Rahmenbedingungen wichtig, Europa zu stärken – wirtschaftlich, sozial und in vielen anderen Dimensionen, auch militärisch. Das macht uns unabhängiger von internationalen Disruptionen, seien es die Expansionsgelüste Russlands oder die Strategien Chinas. Aber nur wegen des ökonomischen Effekts brauchen wir keine zusätzlichen Verteidigungsausgaben.
Sie befürworten die steigenden Verteidigungsbudgets aber grundsätzlich?
Europa muss in der Frage der Verteidigung mehr auf eigenen Beinen stehen. Das ist eine Finanzierungs- und eine Koordinationsfrage: Gelingt es, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern in der EU zu stärken? Österreich wird sich aufgrund seines Neutralitätsstatus in der Frage zurückhalten. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir ein stärkeres Europa brauchen – auch damit das Pentagon bei uns nicht die Macht in verteidigungspolitischen Fragen hat. Die enge Zusammenarbeit hat dann vielleicht auch den Effekt, dass man stärker koordiniert, wer Rüstungsaufträge bekommt. Wenn das europäische Unternehmen sind, hat man vielleicht einen ökonomischen Effekt.

Wie kann man Europa ansonsten stärken?
Das ist relativ leicht: 80 Prozent der in der EU erzeugten Güter und Dienstleistungen werden innerhalb des EU-Binnenmarkts verbraucht. Das heißt, der wichtigste Handelspartner Europas ist Europa, und den müssen wir stärken, um resilienter und unabhängiger zu werden von den Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft. Deshalb bin ich auch ein glühender Europäer. Es wäre katastrophal, hätten wir als kleines Österreich mit den USA unsere Zölle verhandeln müssen. Wir hätten die besten Argumente gehabt und dennoch verloren. Man muss sich nur die Schweiz ansehen. Ich bin froh, dass Europa Verhandlungen auf dieser Ebene führt. Da wird man mit dem Ergebnis nicht in jeder Hinsicht zufrieden sein, aber es ist viel besser, als wenn die Mitgliedsländer einzeln verhandelt hätten.
Wie wirken sich die höheren US-Zölle auf die österreichische Konjunktur aus?
Grundsätzlich negativ, aber nicht in einem starken Ausmaß, eben weil unsere wichtigsten Handelspartner in Europa sind. Das Hauptproblem ist die Verunsicherung: Unternehmen investieren weniger, weil sie nicht wissen, wie die Rahmenbedingungen im nächsten halben Jahr sein werden. Wir brauchen Stabilität in Europa und müssen alles zur Stärkung der Binnennachfrage in Österreich unternehmen. Wir sind kein reines Exportland, die Konsumnachfrage der privaten Haushalte ist fast gleich groß wie der Export von Gütern und Dienstleistungen. Bei beiden müssen wir schauen, dass sie florieren.
Der Produktionssektor in Österreich verzeichnet Rückgänge, teils ist die Rede von einer Deindustrialisierung. Sie sprachen da von Panikmache.
Ja, wir erleben keine Deindustrialisierung. Die österreichische Industrie macht ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung aus und ist seit dem Jahr 2000 um mehr als 60 Prozent gewachsen, die deutsche etwa um 10 Prozent. Es gab eine Rezession und die zurückhaltende internationale Investitionsnachfrage hat unseren stärksten Sektor – den Maschinen- und Anlagenbau, also den Metallbereich – getroffen. Aber der langfristige Erfolg der Industrie hängt davon ab, ob sie die Transformation zur Treibhausgasneutralität schafft, und wir müssen sie in der Wirtschaftspolitik dabei unterstützen. Dafür braucht es günstigen Strom aus erneuerbaren Quellen und mehr Qualifizierungs- und Weiterbildungsanstrengungen auf dem Arbeitsmarkt.
Der österreichische Budgetplan sieht Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und beim Auslandskatastrophenfonds vor. Lassen wir damit nicht Menschen, etwa im Globalen Süden, im Stich?
Wir haben in der Budgetsanierung viele schmerzliche Kürzungen, die unangenehm sind. Ich habe immer gesagt, wir können das Budget nicht konsolidieren, ohne dass es jemand merkt. Wir bemühen uns sehr, die Verteilungswirkungen erträglich zu halten, wir schauen vor allem im steuerlichen Bereich, dass auch die ökonomisch Bessergestellten zur Konsolidierung beitragen, aber in vielen Bereichen treffen wir Leute, die es schwer haben.
Hierzulande versuchen wir, mit Offensivmaßnahmen gegenzusteuern. Mir ist bewusst: Die Nichtvalorisierung der Familienbeihilfen trifft ärmere Familien, aber gerade dort investieren wir in Form des zweiten verpflichtenden und kostenlosen Kindergartenjahrs, der Deutschförderung, des Chancenbonus in den Schulen und einer besseren psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen.
Uns fehlen die finanziellen Spielräume,
um stark zu einem Konjunkturaufschwung beizutragen.
Markus Marterbauer, Finanzminister
Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Wähler:innen die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl als „Sparpartei“ abkanzeln könnten?
Nein, das wird nicht der Fall sein. Wir haben ein schweres und unangenehmes Erbe, aber wir beweisen wirtschaftspolitische Kompetenz, indem wir in der Lage sind, das Budget zu sanieren. Wir haben gleichzeitig eine Reihe an Offensivmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, wo die Menschen sehen werden, dass wir versuchen, das Leben besser zu machen. Ich bin sicher, dass wir mit dieser Politik reüssieren werden.
Der „Ageing Report“ der EU besagt, dass sich der staatliche Zuschuss zu den Pensionen gemessen am BIP bis 2070 nur geringfügig verändern kann. Von welchem BIP geht man bis 2070 aus? Kann man das zuverlässig prognostizieren?
Das basiert auf Annahmen. Für mich ist das Wachstum des BIP nicht die entscheidende ökonomische Größe. Das BIP wird in Bezug auf die Frage, wie es den Menschen und den Unternehmen im Land geht, völlig überbewertet. Ich gehe davon aus, dass wir bestimmte ökonomische Ziele verfolgen, wie gerechte Verteilung, nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz, stabile Preise, gute Entwicklung der Produktion und noch viele andere mehr. Das bildet sich viel besser in einer Wohlstandsorientierung ab, mit der man verschiedene Ziele gleichzeitig verfolgt. Das BIP und das Wirtschaftswachstum sind bestenfalls ein Instrument, um die Ziele des Wirtschaftens zu erreichen, aber niemals selbst ein Ziel.
Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt. In Ihrem Buch „Angst und Angstmacherei“ aus dem Jahr 2022 beschreiben Sie eine Abwärtsspirale. Steigende Arbeitslosigkeit bewirkt Angstsparen in der Bevölkerung, was die Konjunktur dämpft und in weiterer Folge wiederum die Arbeitslosigkeit steigen lässt. Erleben wir das gerade?
In dieser Spirale waren wir 2023/2024, als Arbeitslosigkeit und Sparquote stark stiegen, sind aber gerade dabei, sie zu verlassen. Das ist nicht unmittelbar auf die Bundesregierung zurückzuführen, aber unser Kurs – die Fakten klar analysieren, im Kompromiss entstehende Lösungen, ein Rahmen, wo wir mittelfristig hinwollen – trägt zur Stabilisierung bei. Uns fehlen die finanziellen Spielräume, um stark zu einem Konjunkturaufschwung beizutragen. Aber wenn die Rezession durch Unsicherheit bei den privaten Haushalten ausgelöst wird und durch Unternehmen, die nicht investieren, dann hilft eine stabile, sachorientierte Wirtschaftspolitik.
NGOs sind elementarer Bestandteil einer funktionierenden Zivilgesellschaft u leisten unverzichtbaren Beitrag zu sozialem Zusammenhalt & vitaler Demokratie. Wo sie öffentl Aufgaben erfüllen, ist staatl Förderung angemessen. Ich danke allen Bürger:innen, die sich für Allgemeinwohl u NGOs engagieren.
— Markus Marterbauer (@markusmarterbauer.bsky.social) 27. August 2025 um 13:08
Sie propagieren eine „Wirtschaftspolitik der Hoffnung“. Welche Rolle spielt die Stimmung, die eine Regierung verbreitet, zum Beispiel auch für Märkte?
Eine essenzielle. Man kann es im Moment schön sehen: Die größte Oppositionspartei betreibt eine Politik der Destabilisierung, der Verunsicherung, der Angstmacherei. Das ist eine bewusste Strategie, die die Fakten negiert und Unsicherheit erzeugen will, weil man dann leichter mit den eigenen Botschaften durchkommt und vor allem mit den Interessen, die gegen die breite Masse der Bevölkerung gerichtet sind – die arbeitenden Menschen. Die Regierung versucht, dem eine Politik der Stabilität und Zusammenarbeit entgegenzusetzen sowie Sicherheit und Planbarkeit zu ermöglichen. Daraus entsteht im besten Fall Hoffnung auf eine bessere Zukunft.