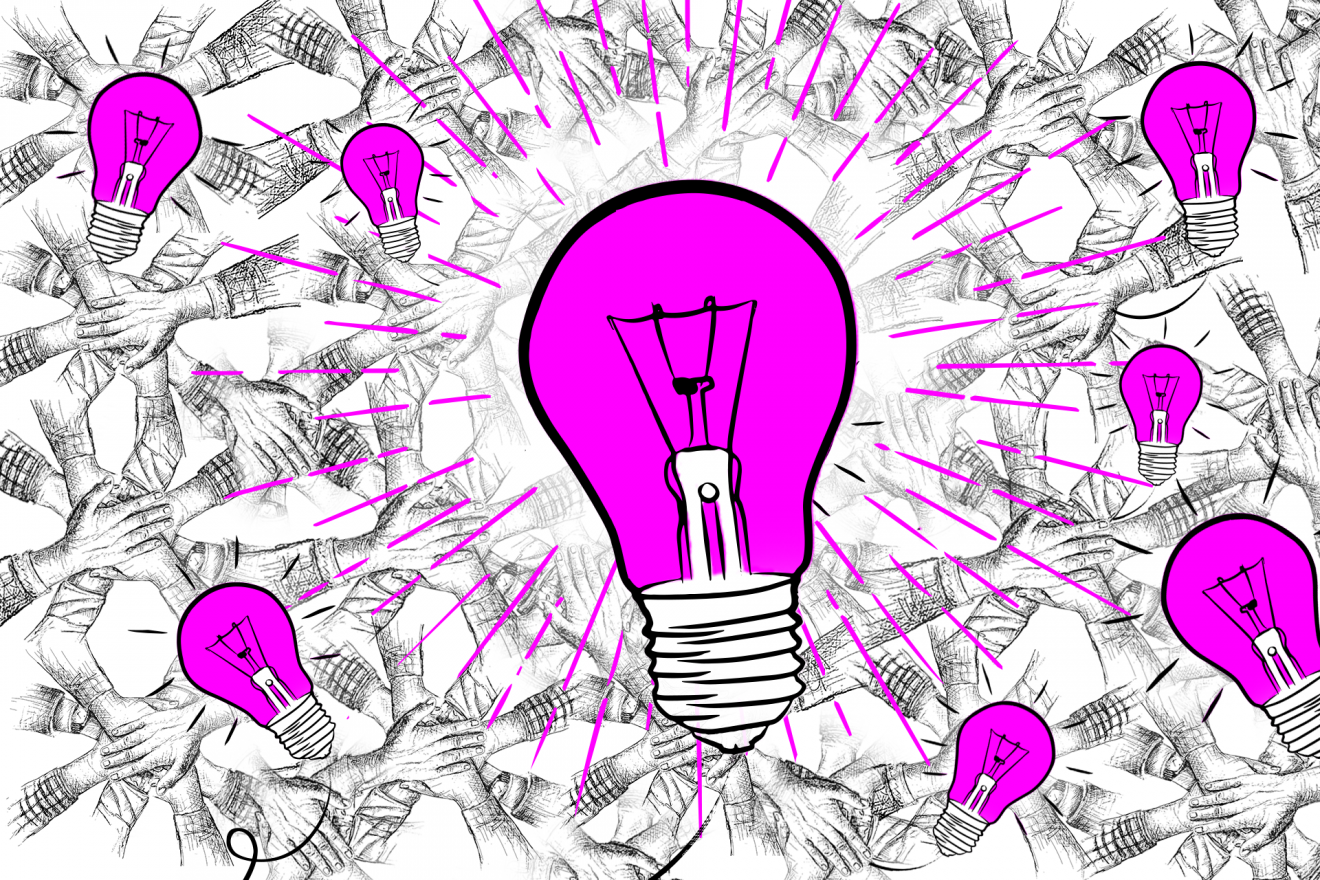Lasst die Leute mehr mitreden!
Aber warum ist das eigentlich so und was folgt, zu Ende gedacht, eigentlich daraus?
Arbeit ist so viel mehr
Arbeit ist ja nicht nur Broterwerb, also eine Tätigkeit, deren einziges Ziel es ist, dass wir am Monatsersten genug Geld am Konto haben. Arbeit hat so viele andere Dimensionen: Sie gibt uns eine Identität – besonders wenn wir das Gefühl haben, wir machen eine sinnvolle Arbeit, auf die wir stolz sein können. Gerade manuelle ArbeiterInnen im produzierenden Gewerbe waren seit jeher auch stolz auf ihre Fertigkeiten und die Produkte ihrer Arbeit. Wer sich im Betrieb akzeptiert fühlt, wird mit besserer Laune in die Firma gehen. Wer sich gemobbt fühlt, als unpersönliche Nummer, wer den Eindruck hat, nie gehört, aber dauernd nur kommandiert zu werden, wird eher das verspüren, was man gemeinhin so „Arbeitsleid“ nennt.
Das war übrigens immer schon so. Bereits die frühen Arbeitskämpfe gingen nicht nur um Geld oder Arbeitszeit, sondern auch um das, was man die „sozialmoralische Ordnung“ im Betrieb nennen könnte. „Die härtesten Konflikte dieser Zeit“, schrieb der Sozialhistoriker E. P. Thompson über die Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts, entzündeten sich „weniger (an) ‚Brot-und-Butter‘-Konflikten“, sondern viel häufiger an Situationen, in denen sich die ArbeiterInnen wie ein Ding behandelt fühlten, das man wegwerfen kann. Das haben Unternehmer schon sehr früh erkannt und ihren Stammbelegschaften so etwas wie „Privilegien“ gegönnt: Respekt, betriebliche Absicherung, Arbeiterwohnungen, einen (fast) fixen Job. Weil sie die guten Leute und deren Treue zur Firma brauchten.
Zwei-Klassen-Gesellschaft im Betrieb
Rund um die Kernbelegschaft etablierte sich dann die periphere Belegschaft, die gekündigt wurde, wenn die Aufträge ausblieben. Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Betrieb. Heute, nebenbei gesagt, hat sich diese Situation oft wieder hergestellt. Stammbelegschaft und Leiharbeiter sind oft die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Betrieb der Gegenwart.
Stammbelegschaft und Leiharbeiter sind oft die Zwei-Klassen-Gesellschaft im Betrieb der Gegenwart.
„Für den gewöhnlichen Arbeiter … bedeutet Sozialismus nicht viel mehr als bessere Löhne und kürzere Schichten und niemanden, der einen herumkommandiert“, wusste schon der große George Orwell.
Sich respektiert fühlen hieß dann aber nicht nur, vom Chef ordentlich behandelt zu werden, sondern auch mitsprechen zu können – Betriebsräte, Arbeitsverfassungsgesetz, klare Regeln zur Mitentscheidung, später dann auch der Einzug von ArbeitnehmervertreterInnen in Aufsichtsräte und die Firmenvorstände waren die Folge. Sie etablierten oft ein besseres Betriebsklima, auch das Gefühl von Macht und Gegenmacht statt Ohnmacht. Und boten einen Hebel für die Politik der kleinen Schritte und graduellen Verbesserungen. Natürlich führten sie auch zu nicht so erwünschten Nebenfolgen: Je größer die Firma, umso eher kam es vor, dass der Belegschaftsvertreter seinerseits als Teil der Macht angesehen wurde, als Bonze, der sich von seinem Herkommen entfernt hatte. Auch das kam vor und hat da und dort zu neuen Ohnmachtsgefühlen geführt, und dazu, dass die Belegschaften ihre Vertretungen gar nicht mehr immer als authentische Vertretungen wahrnahmen.
Wirtschaftsdemokratie
In den optimistischen sozialreformerischen Jahrzehnten der sechziger und siebziger Jahre kam dann der Begriff der „Wirtschaftdemokratie“ auf, und zwar vor allem in Gewerkschaften und sozialdemokratischen Parteien, nicht zuletzt in Deutschland, Österreich und den skandinavischen Ländern. Von der Mitbestimmung – was oft nicht viel mehr hieß, als ein Recht darauf zu haben, gehört zu werden – sollte es in Richtung demokratischer Unternehmensführung gehen, so eine Art von Co-Management von Unternehmen durch Belegschaften und Eigentümer und Management. Aber mit dem gesellschaftlichen Rollback und dem Siegeszug des Neoliberalismus geriet diese Debatte fast in Vergessenheit und verlor jeden Schwung.
Zu einem „guten Leben“ gehört dazu, dass man Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen vermag, die einen betreffen.
Sie sollte wieder aufgenommen werden, wie jetzt auch die OECD-Studie eindeutig belegt. Denn es lässt sich ja beispielsweise unter Gerechtigkeitsaspekten für Wirtschaftsdemokratie plädieren: etwa, dass sich autokratische Managemententscheidungen oft „gegen die Interessen von Beschäftigten (richten), obwohl diese durch ihre Arbeit den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens erst möglich machen. Das will Wirtschaftsdemokratie ändern“, so Lothar Wentzel von der deutschen IG-Metall. Mit genauso viel Recht kann man natürlich aus demokratiepolitischen Gründen darauf beharren, dass Partizipationsrechte von Bürgern nicht vor den Betriebstoren haltmachen dürfen. Menschen haben ein Bedürfnis nach „Ausweitung individueller Freiheit“ (Klaus Dörre). Zu einem „guten Leben“ gehört dazu, dass man Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen vermag, die einen betreffen. Hat man diesen Einfluss nicht, fühlt man sich ohnmächtig, man wird sich dann oft passiv in sich zurückziehen.
Betriebliche Mitbestimmung
Alle Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die einen hohen Grad an betrieblicher Mitbestimmung realisieren, in mittlerer Frist bessere Arbeitsbedingungen haben werden, in ihnen werden den Beschäftigten ordentliche Löhne gezahlt usw. Das ist volkswirtschaftlich nützlich, weil es die Binnennachfrage stärkt, rechnet sich aber auch betriebswirtschaftlich. Unternehmen mit einem höheren Kostenniveau werden versuchen, produktiver zu produzieren, was den Produktivitätsgrad einer Volkswirtschaft hebt, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen. Ordentliche Löhne sind ein Anreiz für Unternehmen, besser zu werden. In ihnen ist die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten höher, was sich wiederum in mehr Engagement übersetzt, aber auch in einen höheren Qualifikationsgrad der ArbeitnehmerInnen. Umgekehrt sind Unternehmen, die auf Lohndumping setzen, unproduktiver. Ja, in gewissem Sinn heißt Lohndumping zuzulassen, die unproduktiven Unternehmen zu subventionieren und die produktiven, die ordentliche Löhne zahlen, zu bestrafen. Lohndumping und Mangel an Mitbestimmung hängen in der Praxis eng zusammen: Es sind gerade jene Unternehmen, die mit vielerlei Tricks selbst die Einrichtung eines Betriebsrates zu hintertreiben versuchen, die auch die miesesten Löhne bezahlen.
Ein höherer Grad an Mitbestimmung, die Möglichkeit, partizipativ an Entscheidungen von Unternehmen mitzuwirken, erhöht die Identifikation der ArbeitnehmerInnen mit ihrer Firma, was sich im Zeitverlauf ebenso in einen höheren Qualifikationsgrad und damit in höhere Produktivität übersetzt.
Ein höherer Grad an Mitbestimmung, die Möglichkeit, partizipativ an Entscheidungen von Unternehmen mitzuwirken, erhöht die Identifikation der ArbeitnehmerInnen mit ihrer Firma, was sich im Zeitverlauf ebenso in einen höheren Qualifikationsgrad und damit in höhere Produktivität übersetzt. Mitbestimmung ist immer auch eine Schule der ArbeitnehmerInnen in verantwortlichem ökonomischem Denken. Mitbestimmung, wie etwa die Repräsentanz von ArbeitnehmervertreterInnen in Aufsichtsräten führt zum Erwerb von „Wirtschaftskompetenz“ in gesellschaftlichen Gruppen, die die traditionellen Eliten gerne von solcher Kompetenz fernhalten würden. Auch das hat gesellschaftlich nützliche Folgen für ein Gemeinwesen. Eines der Gegenargumente gegen Mitbestimmung lautet, dass sie betriebswirtschaftlich notwendige, „harte Entscheidungen“ erschweren oder verunmöglichen würde und Unternehmen dann an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und somit im Extremfall in den Ruin getrieben werden. Simpel gesagt: GewerkschafterInnen und BelegschaftsvertreterInnen würden dann Kündigungen und Strukturbereinigungen im Unternehmen blockieren, bis das Unternehmen pleite sei. Es gibt aber leider keine empirischen Beispiele, die eine solche These stützen würden. Gerade weil die Mitbestimmung auch eine Schule für verantwortliches Handeln und Denken ist, wird so etwas eher selten geschehen. Ein hoher Grad an Partizipation und Mitbestimmung mobilisiert auch die Kompetenzen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, sie nützen die „Weisheit der vielen“, statt nur auf die Weisheit von ein, zwei ManagerInnen zu setzen.
Theorie und Praxis
In Theorie und Praxis haben sich viele Menschen – Intellektuelle, ArbeitnehmerInnen und auch ManagerInnen, Regierungschefs und radikale Oppositionelle – in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Gedanken gemacht, wie wirkliche Wirtschaftsdemokratie hergestellt werden kann – und manches in der Praxis erprobt, auch jenseits der klassischen Mitbestimmung durch die Betriebsräte und Arbeitsverfassungsgesetz.
- Produktionsgenossenschaften
- Kooperativen
- Unternehmen ohne Hierarchie
- Firmen mit von der Belegschaft gewählten Führungsetagen
- Firmen, die der Belegschaft gehören
Aber auch im scheinbar ganz normalen Kommerzbereich experimentieren Firmen mit neuen Organisationsformen. So ist die deutsche Unternehmensberatungsfirma Partake das erste große Unternehmen ganz ohne Hierarchie – die Chefs hat man einfach abgeschafft. In anderen großen Unternehmen wiederum ist man dazu übergegangen, dass die Belegschaft die Führungsetage alle paar Jahre neu wählt – ein Experiment, das durchwegs gute Erfahrungen vorzuweisen hat. Der deutsche Sozialforscher Sven Rahner hat in seinem Buch „Architekten der Arbeit“ mit einigen Spitzenmanagern und -managerinnen gesprochen, die mit solch demokratischen Arbeitsmethoden experimentieren.
Oder ein anderes Beispiel, über das unlängst die Schweizer „Wochenzeitung“ berichtete: „Coopsette ist ein überaus erfolgreicher Konzern. Das Unternehmen baut in ganz Norditalien Einkaufszentren, Eisenbahnstrecken, Hafenanlagen, neue Wohnquartiere, Autobahnbrücken, Industriehallen, Parkhäuser und Tramlinien. Im Jahr 2008 erzielte die Firma mit diesen Projekten – die zumeist schlüsselfertig übergeben werden – einen Umsatz von 465 Millionen Euro. Das Besondere an dieser hoch spezialisierten Firma: Sie gehört der Belegschaft. Coopsette war 1977 aus einer Fusion etlicher Baugenossenschaften in der Provinz Reggio Emilia entstanden, deren Geschichte bis in die Anfänge der norditalienischen Arbeiterbewegung zurückreicht.“
Als in Griechenland im Zuge der Wirtschaftskatastrophe der vergangenen zehn Jahre eine Firma nach der anderen in den Bankrott schlitterte, wurden nicht nur Genossenschaften zur Not-Selbsthilfe gegründet, auch bestehende Genossenschaften konnten oft überleben. „Kooperativen … können der Krise besser trotzen als normale Firmen“, heißt es in einer Studie der Universität Thessaloniki.
Kooperativen können der Krise besser trotzen als normale Firmen
Studie der Universität Thessaloniki
In den Jahren ambitionierter Sozialreformen dachte man auch darüber nach, wie normale Unternehmen nach und nach mehr in den Besitz der Belegschaft übergehen könnten. Manche Unternehmen setzten selbst Schritte in diese Richtung. Was die wenigsten Leute wissen: Selbst der deutsche „Spiegel“ ist über die „Mitarbeiter KG“ zu 50,5 Prozent im Besitz der Belegschaft.
Oder eine andere Möglichkeit: Jährliche tarifliche Lohnerhöhungen können auch so gestaltet werden, dass die Beschäftigten einerseits mehr Geld erhalten, aber auch Anteile am Unternehmen, sodass nach einigen Jahrzehnten langsam die Unternehmen in den realen Co-Besitz ihrer Beschäftigten übergehen – ein solcher Plan wurde in Schweden vor einigen Jahrzehnten unter Premierminister Olof Palme ausgearbeitet, er blieb aber leider in den Kinderschuhen stecken. Auch eine Erbschaftssteuer kann eingeführt und sogar so gestaltet werden, dass sie die Übergabe kleinerer Unternehmen in den gemeinsamen Besitz der Beschäftigten anstößt – etwa, indem Erben dann von der Erbschaftssteuer befreit werden, wenn sie einem entsprechenden Anteil der Firma an die Belegschaft überschreiben.
All das mag nach einer Utopie klingen – aber nach einer, die natürlich Schritt für Schritt erreicht werden kann. Und wirklich „utopisch“ – im Sinne von „weltfremd“ – klingt es sowieso nur angesichts unserer gewohnten Bilder, die wir im Kopf haben; dem Bild etwa vom energetischen, genialen Unternehmer, der autokratisch die Geschicke des Unternehmens steuert, mit Beschäftigten, die wie Ameisen die Befehle der Führungsetage ausführen. Aber das ist, recht besehen, die Dystopie einer Tyrannei, mit der sich sowieso kein Unternehmen erfolgreich führen lässt.