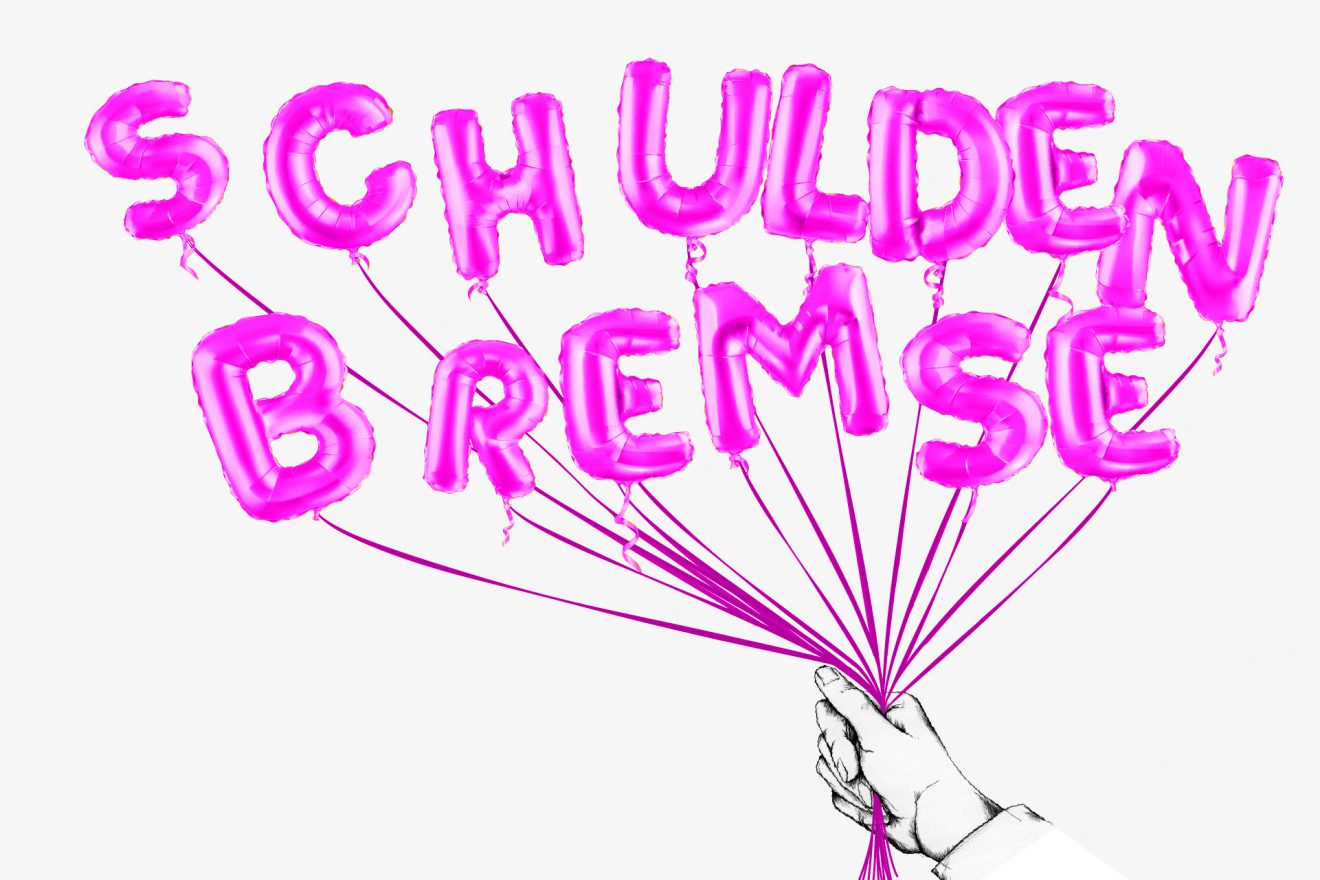Die Geschichte vom „gefräßigen Staat“ ist dann im Handumdrehen mit der Steuerthematik verbunden: Der Staat knöpft den Bürgerinnen und Bürgern das Geld ab, das die, so wird behauptet, ansonsten nicht nur entsprechend ihren eigenen Wünschen, sondern auch sinnvoller einsetzen könnten.
Deswegen ist in den Augen der neoliberalen Ideologie scheinbar selbstevident, dass ein „schlanker Staat“ und damit eine niedrige Staatsquote besser seien als eine etwas höhere und dass es eine kluge Sache sei, dem Staat und seinen Institutionen Handschellen anzulegen, die sie am Schuldenmachen hindern (die ja dann mit späteren höheren Steuern zurückbezahlt werden müssen, so die Behauptung). Deswegen ist die „Schuldenbremse“ in neoliberalen Kreisen besonders beliebt.
Nun sind das Argumentationsreihen, die dem Alltagsverstand im ersten Moment einleuchtend erscheinen: Niedrige Steuer- und Abgabenquoten sind schließlich für die Bürger bequemer, so scheint’s. Ihnen bleibe „mehr Netto vom Brutto“. Und dass man Politiker hindert, „auf Kosten künftiger Generationen Geld rauszuwerfen“, wirkt auch auf den ersten Blick überzeugend.
Aber das ist, denkt man sachlich, also unideologisch, darüber nach und ohne simplen Pseudoweisheiten zu folgen, regelrechter Unfug.
Niedrige Staatsquoten haben also eher Failed States, hohe Staatsquoten sind dagegen ein Charakteristikum gut funktionierender Gemeinwesen.
Niedrige Staatsquote als Indikator für Failed States
Eine niedrige Staatsquote ist zunächst einmal eher ein Indikator für schwache gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung. Deutschland etwa hat gegenwärtig eine Staatsquote von 44 Prozent. Zu den Ländern mit der niedrigsten Staatsquote zählen Jemen, Uganda und der Kongo – so zwischen acht und zwölf Prozent. Niedrige Staatsquoten haben also eher Failed States, hohe Staatsquoten sind dagegen ein Charakteristikum gut funktionierender Gemeinwesen. Gerade Länder mit hoher Staatsquote sind also in der Lage, die privatwirtschaftlichen Aktivitäten einer Gesellschaft zu unterstützen und besonders leistungsfähig zu machen. Es ist ja auch leicht verständlich: Steuern und Abgaben fließen in die öffentliche Verwaltung, in ein gutes Schul- und Bildungssystem, in staatlich geförderte Forschung und Innovation, in eine öffentliche Infrastruktur (Bahn, Schienen, Straßen, Brücken), in ein funktionierendes Rechtssystem und auch in ein Sozialsystem, das auf verschiedenste Weise nicht nur die Einzelnen absichert, sondern auch der Wirtschaft als Ganzes nützt.
Die Arbeitslosigkeit wird in der Krise niedrig gehalten und Menschen verlieren nicht gleich ihre Qualifikation, durch staatliche Investitionstätigkeit können die Ausschläge der Konjunktur ausgeglichen und eine langfristig stabilere Prosperität hergestellt werden. Aus all diesen Gründen ist eine hohe Staatsquote – also in der Regel um die 45 Prozent – ein Zeichen für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und nicht für einen Staat, der Wohlstand absaugt.
Oder niedrigere Staatsquote mit privaten Regelungen
Nun gibt es natürlich auch erfolgreiche Volkswirtschaften mit scheinbar niedriger Staatsquote, und die werden dann gerne als Vorbild hingestellt. Etwa die Schweiz. Die Schweiz hat eine Staatsquote von nur knapp 33 Prozent und da funktioniere doch auch alles gut. Aber das ist eine Mogelpartie. Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sind in der Schweiz durch private Versicherungen geregelt und zählen daher nicht zur Staatsquote. Für die Bürgerinnen und Bürger macht das recht wenig Unterschied im Vergleich zu Ländern, in denen solche Leistungen durch Steuern oder öffentliche Sozialversicherungen bereitgestellt werden (und deshalb zur Staatsquote zählen). Zählt man diese Kosten zur „niedrigeren“ Schweizer Staatsquote hinzu, kommt man auf einen ähnlichen Wert wie in den meisten gut organisierten Industriestaaten.
Ein Mythos ist, dass „Schuldenbremsen“ dem Staat Fesseln anlegen und daher positive Wirkungen haben.

Ein ähnlicher Mythos ist, dass „Schuldenbremsen“ dem Staat Fesseln anlegen und daher positive Wirkungen haben. Aber das ist gefährlicher Unsinn. Die relativ stabile ökonomische Entwicklung in den führenden Volkswirtschaften ist auch die Folge davon, dass die Regierungen bei dramatischen Konjunktureinbrüchen gegensteuern können. Indem sie investieren, indem sie aber auch Kurzarbeit finanzieren (und damit Entlassungen vermeiden), indem sie Arbeitslosengeld auszahlen (das in der Krise automatisch mehr Kosten verursacht), was letztlich alles dazu führt, dass die Konsumnachfrage nicht sofort massiv einbricht. All das treibt in der Krise die Kosten hoch und muss über Schulden finanziert werden.
Schuldenbremse als Katastrophe in der Krise
Und hinzu kommt: Da in einer Krise die Einnahmen des Staates sinken, wachsen die Defizite allein deshalb schon. Jetzt stellen wir uns vor, ein Staat wäre ausgerechnet in einer solchen Situation gezwungen, zusätzlich seine Ausgaben zu streichen (weil ja die Schuldenbremse dazu zwingt) – es würde zu einer Katastrophe führen. Etwas klügere „Schuldenbremsen“ sehen vor, dass die Regierungen in der akuten Krise zwar Geld ausgeben können, aber über die Legislaturperiode die Defizite ausgleichen müssen. Das würde aber nur dazu führen, dass die Konjunktur für zwei Jahre unterstützt und dann in den nächsten zwei Jahren wieder abgewürgt wird. Am Ende wäre eine Volkswirtschaft weniger leistungsfähig, als sie das ohne das dogmatische Instrument „Schuldenbremse“ ist.
Zwar sind Schulden nichts Erstrebenswertes, aber sie müssen vor allem in Relation zur Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft betrachtet werden.
Schließlich sind Schulden zwar nichts Erstrebenswertes, aber sie müssen vor allem in Relation zur Leistungsfähigkeit einer Wirtschaft betrachtet werden. Das ist letztlich nicht sehr viel anders als bei der Privatperson. 20.000 Euro Schulden können für den Einzelnen wenig oder viel sein. Hat er ein Jahreseinkommen von 15.000 Euro, sind die Schulden drückend, hat er ein Jahreseinkommen von 60.000, sind sie eher gering. Durch Verschuldung, wenn man klug investiert, kann man aber die langfristige Leistungsfähigkeit stärken. Wer Kredite aufnimmt und die Leistungsfähigkeit stärkt, generiert zukünftige, nachhaltige höhere Einnahmen – aus denen die Kredite dann zurückbezahlt werden können.
Was, nebenbei bemerkt, Staaten ohnehin nicht unbedingt müssen – für einen Staat ist weniger bedeutsam, ob er die Kredite wirklich zurückzahlt, als dass die Höhe der Schulden im Vergleich zur Leistungsfähigkeit des Staates abnimmt. Simpel gesagt: Wenn ein Staat mit einem BIP vom 30 Milliarden einen Schuldenstand von 15 Milliarden hat, dann ist der schon aus dem Schneider, wenn die 15 Milliarden letztendlich ungetilgt bleiben, aber das BIP auf 60 Milliarden wächst (Staaten haben nämlich gegenüber Privatpersonen den Vorteil, dass sie in aller Regel nie „sterben“).
Wer spart, wenn alle sparen, verliert
Ein Staat, der mit Kreditfinanzierung sein BIP erhöht, wird immer besser dastehen als ein Staat, der wegen vorhandener Schulden eine Sparpolitik verfolgt, die das BIP schmerzhaft reduziert. Wenn ein Staat aufgrund von Sparpolitik eine Milliarde weniger Schulden, aber dafür fünf Milliarden weniger Einnahmen hat, dann hat er kein Problem gelöst – sondern erst ein wirklich großes Problem geschaffen. All das hängt sehr von den Umständen ab: Ein Staat, der spart, während alle anderen Staaten um ihn herum eine kräftige Konjunktur haben, kann seine Probleme oft lösen – er ersetzt dann Teile der Binnennachfrage durch Exporterlöse.
Ein Staat, der spart, während alle anderen Staaten um ihn herum auch sparen (etwa wegen einer globalen Krise), wird durch Sparpolitik seine Probleme eher noch vergrößern. Dass es aber so sehr auf Umstände ankommt, zeigt, dass mechanische Schuldenbremsen ideologischer Mist sind. Besser ist, wenn kluge Politiker klug entscheiden, unter Beachtung aller Details und der vielgestaltigen Umstände, die sich zudem dauernd ändern können.
Ein schlanker Staat führt nicht zu einer leistungsfähigen Wirtschaft, sondern zu einer, die an allen Ecken kracht und scheppert. Und eine mechanische Schuldenbremse ist ein besonders blödes wirtschaftspolitisches Instrument.
All dies ist übrigens kein Plädoyer dafür, sich wie verrückt zu verschulden. Geld ist, wie alle materiellen Mittel, ein knappes Gut und soll effizient eingesetzt werden. Die Staatsquote auf 60 Prozent hochzutreiben, ist wohl auch keine sehr gute Idee (obwohl es keine klare Richtschnur gibt, ab welcher Marke eine hohe Staatsquote negative Wirkung hat). Aber eines ist klar: Ein schlanker Staat führt nicht zu einer leistungsfähigen Wirtschaft, sondern zu einer, die an allen Ecken kracht und scheppert. Und eine mechanische Schuldenbremse ist ein besonders blödes wirtschaftspolitisches Instrument.