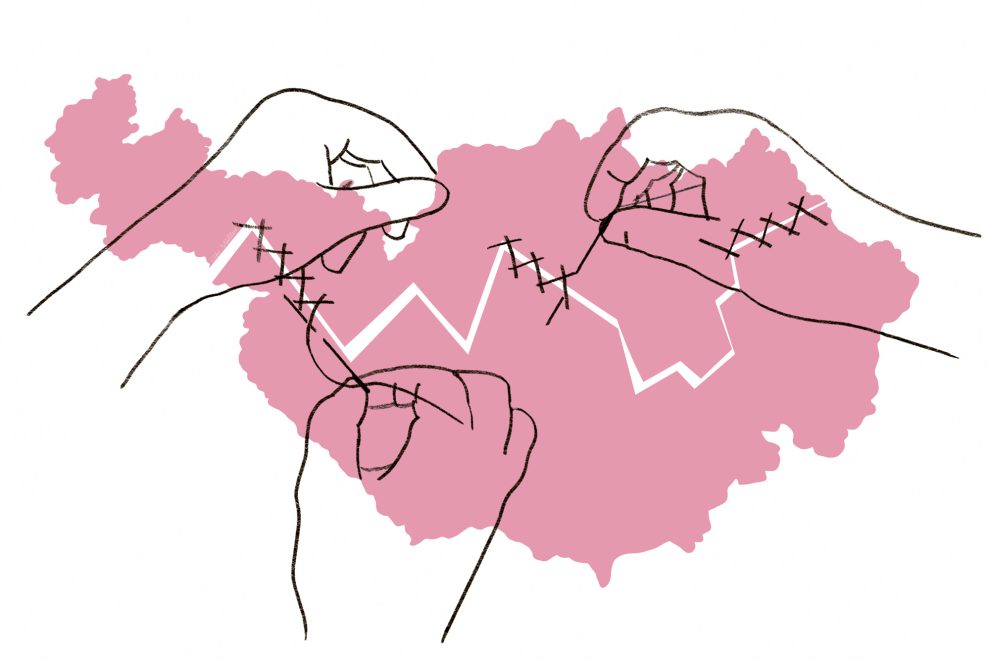Österreich hat gerade noch rechtzeitig erkannt, dass der Kompromiss eine politische Tugend darstellen kann – kann, nicht muss. Denn die Sozialpartnerschaft, der Politik gewordene Kompromiss, die institutionalisierte österreichische Lösung, hat mehr und mehr den Beigeschmack des faulen Kompromisses bekommen. Dieser ist der Tod jeder echten Auseinandersetzung, bei der man Standpunkte des Gegners akzeptiert und im Gegenzug Abstriche von den eigenen Standpunkten macht. Der faule Kompromiss ist einer, den ein oder beide Partner von vornherein als inakzeptabel betrachten – und das Publikum sowieso.
Fauler Kompromiss oder nur fehlerhaft?
Die Sozialpartnerschaft war nicht unbedingt ein fauler Kompromiss, aber sie litt an einem Geburtsfehler, der zugleich ihre Stärke war. Das lässt sich nicht mehr beheben, aber man muss es sich zumindest bewusst machen. In Österreich galt es nach 1945, das Staatsziel der Unabhängigkeit, Ungeteiltheit und Neutralität zu erreichen; und das in einer Nation, an deren Lebensfähigkeit höchstens 60 Prozent der Bevölkerung glaubten. Diesem Ziel ordneten die beiden Staatsparteien ÖVP und SPÖ alles unter. Die Verhandlungen mit den Alliierten, vor allem mit der Sowjetunion, bedingten eine gewisse Geheimhaltung und ein Hintanhalten interner Differenzen. Man wollte dem Verhandlungspartner einig, nicht zerstritten gegenübertreten.
Nur eine revitalisierte
Sozialpartnerschaft kann ein
glaubwürdiges Mittel gegen Hetze,
Lüge und hemmungslosen
individuellen Vorteil bilden.
Armin Thurnher, Herausgeber des „Falter“
So haftete der Sozialpartnerschaft der Makel der Unöffentlichkeit an, der mangelnden Darstellung dessen, was man wollte und wie man es zu erreichen gedachte. Man handelte im Interesse der österreichischen Bevölkerung, aber dazu gehörte auch, über diese Interessen nicht offen zu sprechen.
Diese Praxis brachte gute Ergebnisse. So kam es, dass sie fortgesetzt wurde, nachdem das Staatsziel erreicht war. Öffentliche Kontrolle schien es nicht zu brauchen, aber die Sozialpartnerschaft konnte nicht verbergen, dass sie einen älteren Konflikt – Österreichs großen Riss, den Gegensatz zwischen Sozialismus und Austrofaschismus – nur überdeckte, nicht heilte. Immer wieder wunderten sich die Partner gewordenen Gegner, dass trotz erprobter und erfolgreicher Verhandlungen miteinander unversehens wieder Feindschaft ausbrach.
Problem und Lösung
Österreich ist der Krise, von einer rechtsextremen Partei regiert zu werden, nur knapp und durch das Versagen des FPÖ-Chefs Herbert Kickl entgangen. Nur sein Verhalten und die Beharrlichkeit des Bundespräsidenten machten die nun regierende pragmatische Dreierkoalition doch noch möglich. Wie soll sie sich also gebaren?
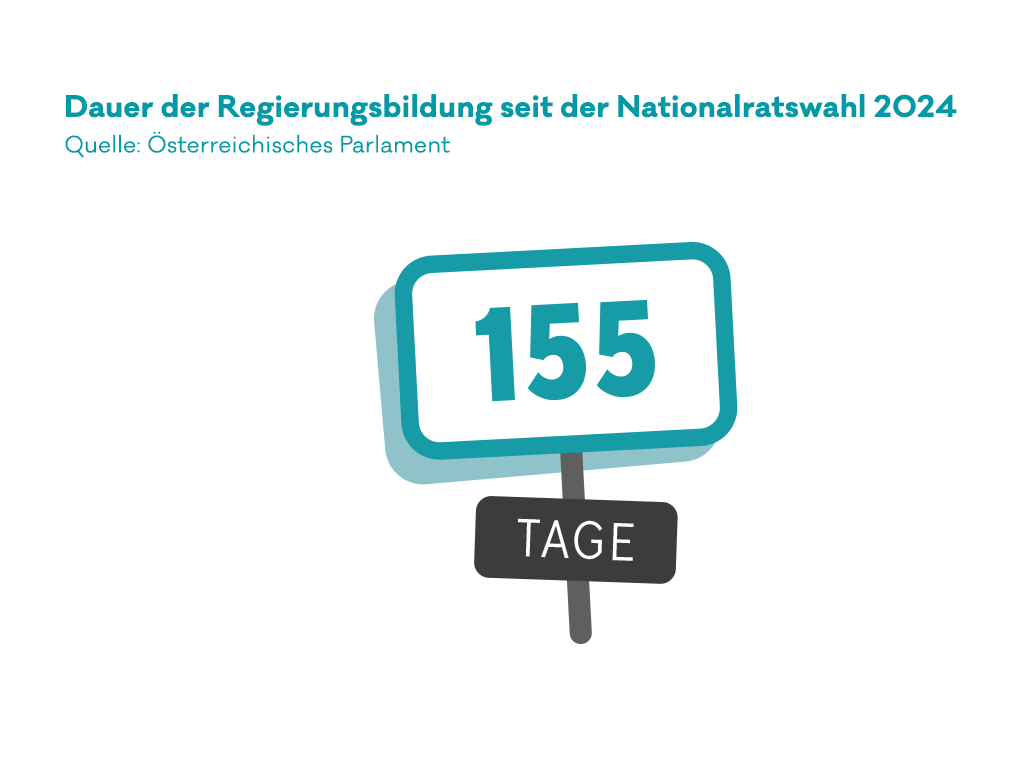
Erstens, indem sie ihre Handlungen nicht an Kickl misst. Der soll sich an der Regierung messen, nicht umgekehrt. Zweitens, indem sie den notwendigen Sparkurs zur Budgetsanierung sozialverträglich abfedert. Drittens, indem sie das Land europäisiert, also von der trügerischen Idee abbringt, ein isolierter Nationalstaat wäre besser dran. Viertens, indem sie das Bildungssystem von alten Zöpfen befreit, ohne in neoliberale Fallen zu tappen. Fünftens, indem sie in der Migrationspolitik dem dänischen Modell folgt: Die dänischen Sozialdemokrat:innen halten die Rechtsextremen klein, indem sie Einwanderung streng begrenzen, die im Land befindlichen Migrant:innen gut behandeln und ihnen Integration erleichtern, sie aber nötigenfalls auch mit Druck dazu verpflichten.
Fast zwei Drittel der Beschäftigten in #systemrelevanten Berufen sind #Frauen. Zudem hat ein hoher Anteil Migrationshintergrund bzw. keine österreichische #Staatsbürgerschaft. Ohne Frauen und ohne Migrantinnen und Migranten würde nichts laufen, dann wäre Stillstand im Land.
— @Arbeiterkammer (@arbeiterkammer.at) 28. April 2025 um 09:11
Vor allem aber soll diese Regierung die Sozialpartnerschaft wiederbeleben. Was heißt das? Demokratie ohne funktionierende Öffentlichkeit ist nicht zu haben. Daraus folgt, dass eine revitalisierte Sozialpartnerschaft nur dann funktioniert, wenn sie auch die Öffentlichkeit zu revitalisieren versteht.
Problem der Propaganda
In einer funktionierenden Öffentlichkeit werden politische Informationen und Meinungen so angeboten, dass das Publikum zumindest weiß, worum es geht. Ob das eine naive Vision ist oder nicht: Wir sollten wenigstens versuchen, ihr Gegenteil zu vermeiden, die Propaganda. Sie ist die Herrschaft der Lüge, die Willkür Einzelner. Wir sehen dieses Gegenteil derzeit überall an der Macht: erschreckenderweise nicht nur in Russland und China, sondern auch in den USA – und nicht zuletzt in europäischen Staaten wie Ungarn. Nicht von ungefähr möchte die österreichische Variante von Öffentlichkeitszerstörung, die FPÖ, sich nun stärker an Donald Trumps Amerika orientieren.

Trumpismus und Erfolge rechtsextremer Parteien haben zwei Ursachen (abgesehen von realen Missständen, die nicht verschwinden, nur weil die Falschen sie kritisieren): Einerseits versagen die traditionellen Medien; ihnen glaubt das Publikum nicht mehr – teilweise zu Recht. Sie haben sich zu oft zum Komplizen von Regierungen und herrschenden Meinungen gemacht. Der berühmte Linguist Noam Chomsky nannte das die „Fabrikation von Einverständnis“ („Manufacturing Consent“).
Neoliberalismus und Digitalisierung
Nichts gegen Einverständnis, aber dieses soll freiwillig und durch Einsicht hergestellt werden, nicht durch Tricks, Mauscheleien und Betrug. Andererseits stoßen die privaten Medien in diese Lücke: Social Media, Privatfernsehen und -radio tun so, als wäre Kommunikation kein öffentliches Gut, sondern eine private Ware. Sie sind nicht dem Prinzip Wahrheit verpflichtet, sondern dem Prinzip Aufmerksamkeit. Die Macht der digitalen Konzerne beruht auf der Privatisierung aller Kommunikation nach diesem Prinzip. Es setzt nicht Vernünftiges, Wahres oder Brauchbares durch, sondern Spektakuläres, Erregendes, Aufwühlendes.
Individuelle, schrankenlose Freiheit und grenzenloser Profit sind das Ziel. Die gibt es aber nur für wenige. Der Neoliberalismus hat es in die Köpfe gesetzt, die Digitalisierung spitzt es zu: Am Ende der totalen Freiheit steht eine zerstörte Welt, aus der sich einige Superreiche auf den Mars oder in die Unsterblichkeit retten – oder auf der Erde in Territorien, in denen nicht Menschenrecht herrscht, sondern das Diktat weniger Hyperprivilegierter. Der Unternehmer Elon Musk, Chefberater von Donald Trump und reichster Mann der Erde, ist der Inbegriff dieses Denkens.
Der österreichische Weg
Die gute alte österreichische Sozialpartnerschaft ist ein Gegenbild zu solchen Verhältnissen. Gut und alt? Das reicht eben nicht mehr. Nur eine revitalisierte Sozialpartnerschaft kann ein glaubwürdiges Mittel gegen Hetze, Lüge und hemmungslosen individuellen Vorteil bilden. Dazu muss sie sich ändern, damit sie medial entsprechend erscheinen kann. Man erinnere sich daran, wie vergangene große Koalitionen als bloßer „Stillstand“, „Lähmung“ und Ähnliches dargestellt wurden – nicht immer zu Unrecht, wenn auch oft übertrieben.
Die Linke muss akzeptieren, dass Leistung und unternehmerische Freiheit auch bei ihrer (ehemaligen) Klientel attraktiv sind; und die Rechte muss akzeptieren, dass Vermögen nicht schrankenlos wachsen können und der Staat nicht privatisiert werden darf, sondern modernisiert werden muss. Beide müssen das Thema Integration entgiften.
Wir brauchen glaubhafte mediale Instanzen, mit deren Hilfe wir überprüfen können, was wahr, für die Menschen nützlich und für die Allgemeinheit vorteilhaft ist. Dazu gehören auch private Medien. Öffentlich gefördert werden sollten nur jene, die der Allgemeinheit diesen Nutzen bringen. Alle anderen sind Unterhaltungsbetriebe und können meinetwegen nach wirtschaftlichen Kriterien gefördert werden wie Schrauben- oder Motorradfabriken.
Vor allem sollte jeder Medienpolitik klar sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk vom Prinzip her anders ist als die privaten Medien. Er muss deshalb aus dem Dienst der Parteipolitik entlassen und in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt werden (naturgemäß bedarf er politischer Kontrolle). Er muss angehalten werden, sich selbst als das zu verstehen, was er ist, und das auch seinem Publikum auf jede mögliche Weise zu erklären.
Der alte Riss im Land ist längst einem neuen, weltweiten Riss gewichen. Dem zwischen öffentlichem Interesse, also Rechtsstaat, sozialer Fairness und wahrheitsorientierter Kommunikation, auf der einen und hemmungslosem Privatinteresse, Lüge und Propaganda auf der anderen Seite. Diesen Riss gilt es nicht zu kitten. Er verlangt nach einer Entscheidung.
Weiterführende Artikel
Vom Buchdruck zur KI: Was uns die Geschichte über Medien lehrt