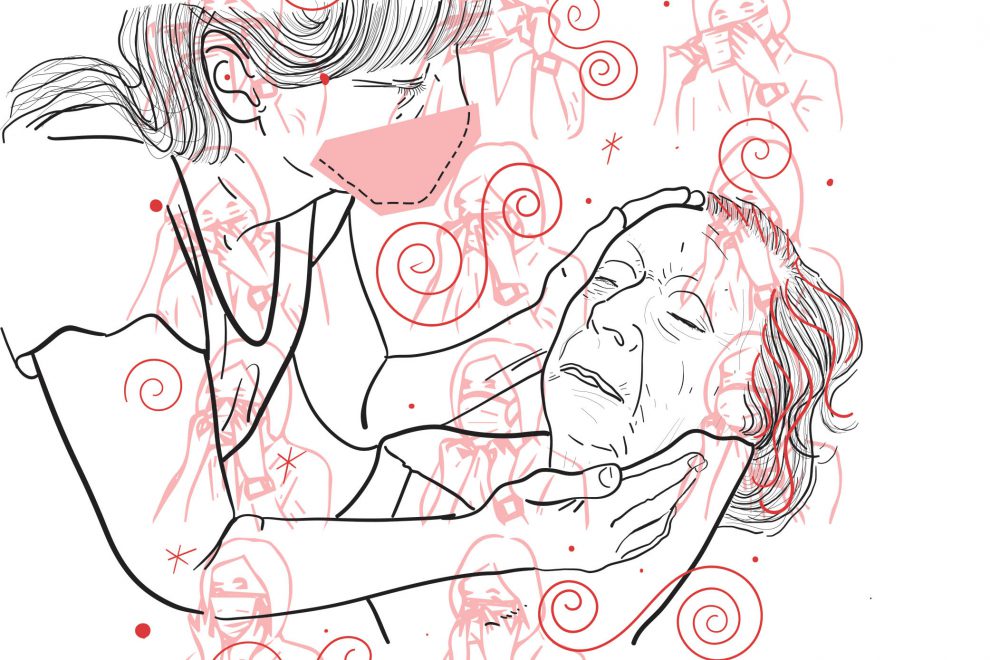Nur drei Pflegekräfte bei uns auf der Station sind Vollzeit angestellt, darunter auch ich. Alle anderen sind auf Teilzeit. Die Tagdienste dauern von sieben Uhr in der Früh bis halb acht Uhr am Abend, die Nachtschicht von sieben Uhr am Abend bis kurz nach sieben Uhr in der Früh. Tagsüber arbeiten wir zu zweit, gemeinsam mit einer Heimhilfe, die ist aber nur bis Mittag da. Die durchschnittliche Pflegestufe der Bewohner*innen auf meiner Station ist Stufe 4, das bedeutet, einige sind komplett bettlägerig. Am Nachmittag sind wir also zu zweit für die ganze Station zuständig. Es wäre für uns eine riesige Erleichterung, wenn die Heimhilfe den ganzen Tag da wäre, dann wären wir wenigstens zu dritt. Im Durchschnitt muss ich zusätzlich zwei Sonntage und fünf Nachtschichten im Monat arbeiten. Die Nächte sind sehr anstrengend, gerade wenn ich immer wieder einzelne Bewohner*innen, die sich selbst nicht mehr oder nicht mehr gut bewegen können, umlagern oder aufs WC bringen muss. Zwischendrin müssen ständig einzelne gewickelt werden. Es ist immer irgendwas.
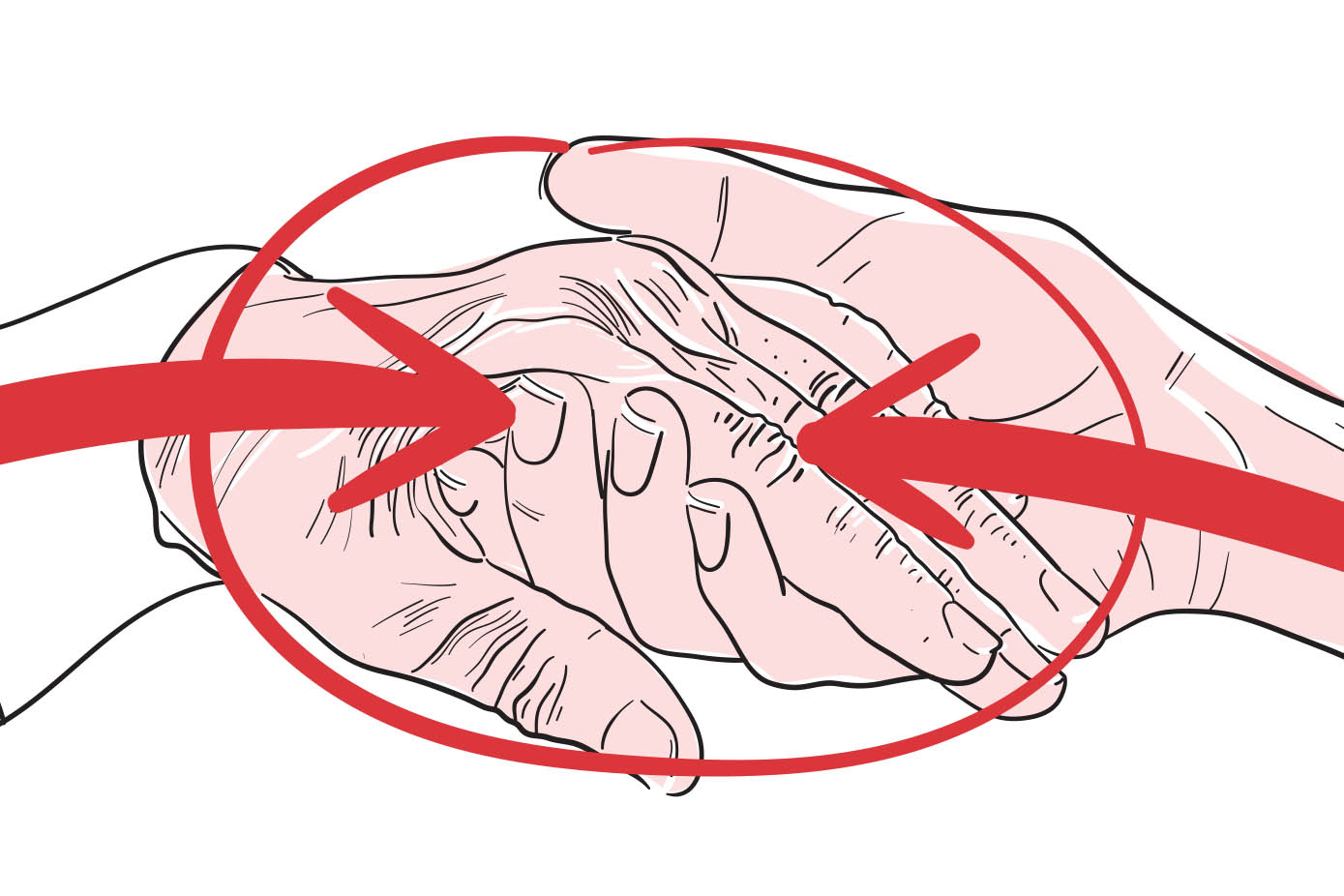
Beleidigungen
Was das Arbeiten gerade besonders beschwerlich macht: Wir müssen seit Monaten unglaublich viel Verwaltungsaufgaben und Papierkram zusätzlich bewältigen. Wenn die Bewohner*innen Besuch kriegen, müssen wir uns erst einmal um Formulare kümmern, bei den Angehörigen Fieber messen, Testergebnisse kontrollieren, die einen rein-, die anderen rauslassen und so weiter. Was die ganze Situation noch verschärft, ist der Ton, mit dem uns viele begegnen. Manche Angehörigen sind richtig beleidigend. Das habe ich in mehr als zwei Jahrzehnten noch nie erlebt! Sie reagieren ihre Wut auf die Corona-Maßnahmen an uns ab – aber wir Altenpfleger*innen haben die Regeln doch nicht erfunden?! Wir müssen uns an unsere Vorschriften halten und schauen, ob alle Auflagen eingehalten werden, vor allem zum Schutz der Bewohner*innen. Mich haben Angehörige beschimpft, wir würden die Menschen böswillig einsperren! Das nimmt mich jedes Mal richtig mit.
Manche halten sich auch nicht an die Maskenpflicht in den Besuchsräumen. Wenn ich sie darauf aufmerksam mache, werde ich wieder nur angeblafft, oder sie ziehen die Maske widerwillig hoch – bis unter die Nase. Das ist schlimm. Und all das bedeutet: Ich kann meine eigentliche Arbeit nicht machen, mich nicht um die Bewohner*innen kümmern. Die müssen ständig auf mich warten. Dabei brauchen sie oft genau das: dass wir uns hinsetzen, ihnen zuhören und mit ihnen Gespräche führen. Viele müssen darüber sprechen, was sie gerade belastet oder was daheim bei der Familie passiert. Die Zeit fehlt jetzt.
Und man darf ja auch nicht vergessen: Viele Bewohner*innen sind dement, die verstehen im Grunde gar nicht, was da vor sich geht, dass wir in einer Pandemie leben. Viele vereinsamen, weil Besuche rapide abgenommen haben. Sie weinen deshalb oft. Es gibt zum Beispiel einen Bewohner, der ständig Bauchweh bekommt – aber in Wahrheit schmerzt nicht sein Bauch, sondern die Seele.
Ich frag mich oft:
Wie soll die Zukunft in
diesem Job aussehen?
Und auch wir als Pflegekräfte müssen die Belastung ja irgendwie verarbeiten. Wenn ich nach der Schicht heimkomme, schaffe ich es oft nicht, mich überhaupt noch mit meiner eigenen Familie zu unterhalten. Ich hab’ einfach keine Kraft mehr. Dann sitze ich vorm Fernseher, schlafe ein, und am nächsten Tag startet das Rad von vorne. Ich hätte öfter gerne einfach nur mal ein paar Tage länger frei, damit ich auch im Kopf abschalten kann.
Wenigstens haben wir inzwischen gute Schutzausrüstung, zu Beginn der Krise war das noch ganz anders. Da habe ich mich damals auch beschwert, das war echt unhygienisch. Doch mit den FFP2-Masken kann ich persönlich gut arbeiten. Ich bin auch schon geimpft. Einige meiner Kolleg*innen sträuben sich jedoch noch. Sie sagen, sie wollen nicht die Versuchskaninchen der Nation sein. Wir müssen alle retten, während andere Ski fahren gehen.
Der Corona-Tausender kam nie. Einmal haben wir 500 Euro extra bekommen. Diese 250 Euro-Bonuszahlungen jetzt kriegt man nur, wenn man auch mit Corona-Patient*innen arbeitet. Weil wir aber keinen positiven Fall haben, gehen wir leer aus. Das finde ich ungerecht. Wir bemühen uns mit allen Kräften, Corona im Heim zu verhindern – und fallen deshalb um die Belohnungszahlung um. Keine einzige meiner Kolleg*innen ist in den Urlaub oder ins Ausland gefahren, so viele von uns verzichten auf private Treffen, um uns auf keinen Fall zu infizieren und das Virus hereinzuschleppen. Denn das ist unsere größte Angst. Wir schränken uns alle privat so massiv ein, wissen das andere Menschen überhaupt?
Ich frag mich oft: Wie soll die Zukunft in diesem Job aussehen? Ein wichtiger Schritt für mich wäre eine Arbeitszeitverkürzung, allein schon, um den Beruf attraktiver zu machen. Aber das ist so weit entfernt, ob ich das noch erlebe? Uns hört keiner zu. Es braucht einfach eine Veränderung von oben. Es muss uns jemand vertreten, unsere Wünsche. Nicht nur die Zahlen und was sich für die Träger und Unternehmen am Ende rechnet.