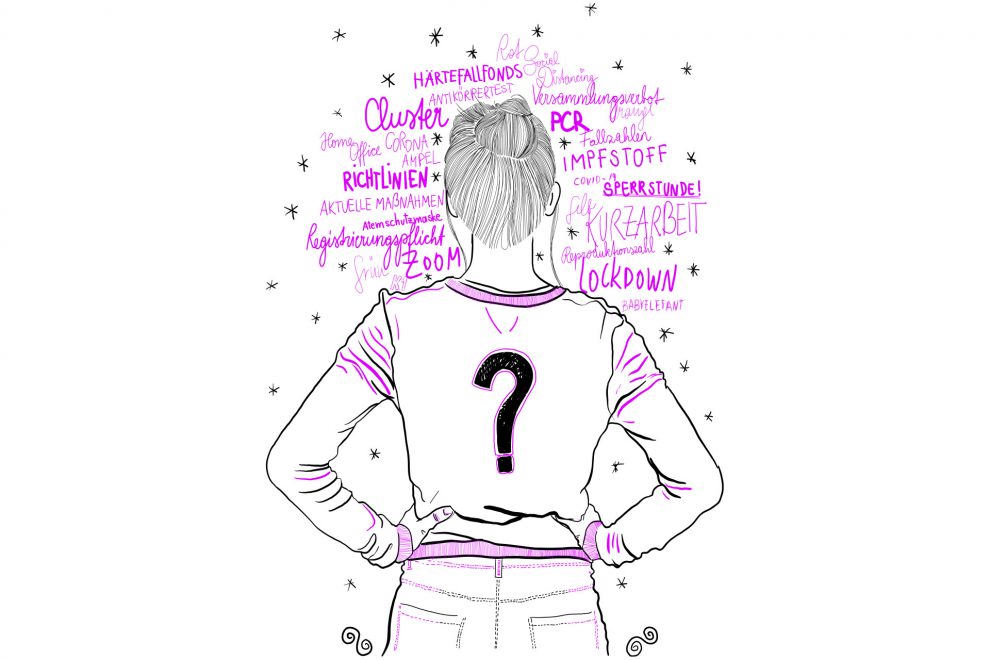Vom Epidemiegesetz zum COVID-19-Gesetz
Am 15. März wurde im Nationalrat das erste COVID-19-Maßnahmengesetz beschlossen, welches das Epidemiegesetz in Teilen aushebelte. Für die Schaffung eines neuen Gesetzes könne man zwei Gründe sehen, so Martin Gruber-Risak, Arbeits- und Sozialrechtsexperte an der Universität Wien. Einerseits habe die Bundesregierung das Epidemiegesetz als veraltet angesehen. „Das zweite Narrativ ist, dass das Epidemiegesetz eine sehr großzügige Entgeltausfallsregelung vorsieht, nämlich 100 Prozent. Für die Maßnahmen nach dem COVID-19-Gesetz galten die Entschädigungszahlungen dann nicht mehr.“
Speziell zu Beginn der Krise herrschte ungewohnte Einstimmigkeit in der Politik, das COVID-19-Gesetz wurde etwa mit den Stimmen aller Parteien beschlossen. Doch lange hielt diese Harmonie nicht an. Schon im April wurden manche Maßnahmen als überschießend kritisiert. Sebastian Kurz reagierte darauf mit der Aussage, dass der Verfassungsgerichtshof zwar darüber entscheiden werde, ob Maßnahmen verfassungskonform seien – dann seien diese aber ohnehin nicht mehr aktuell. Tatsächlich stufte der Verfassungsgerichtshof im Juli Verordnungen teilweise als gesetzeswidrig ein.

„Es war immer klar, dass die vier Gründe nicht abgedeckt waren“
Für Martin Gruber-Risak lagen die Verfehlungen der Regierung vor allem in der Kommunikation. Es war oft zu verwirrend, ob es sich bei Aussagen um Empfehlungen, Verordnungen oder Gesetze handelte. „Für mich war zwar von Anfang an klar, dass die vier Gründe, das Haus zu verlassen, vom Wortlaut nicht abgedeckt waren. Aber es wurde trotzdem permanent wiederholt.“
Für mich war zwar von Anfang an klar, dass die vier Gründe, das Haus zu verlassen, vom Wortlaut nicht abgedeckt waren. Aber es wurde trotzdem permanent wiederholt.
Martin Risak, Arbeits- und Sozialrechtsexperte
Dass diese Gründe nur Empfehlungen waren, wie die Regierung später erklärte, war den meisten Menschen wohl nicht bewusst. „Das geht in einem Rechtsstaat nicht. Als Jurist fordere ich klare Regeln ein, die dort gelten, wo sie medizinisch Sinn machen“, sagt Florian Burger von der AK Wien. Die Motive hinter dieser Art von Kommunikation seien schwierig zu interpretieren. Einerseits habe das schlicht mit Überforderung zu tun, was in einer Krise auch verständlich sei. „Andererseits zeigt sich darin eine Unkenntnis darüber, wie der Rechtsstaat funktioniert. Leider sind die Beamtinnen und Beamten aus den Ministerien, die das wissen müssten, nicht zu den Bundesministern durchgedrungen“, so Burger.
Das geht in einem Rechtsstaat nicht. Als Jurist fordere ich klare Regeln ein, die dort gelten, wo sie medizinisch Sinn machen.
Florian Burger, Sozialrechtsexperte
Die Vermengung von Empfehlungen und Gesetzen ist für Expert*innen jedenfalls problematisch. „Für Juristen ist das das Schrecklichste, was passieren kann. Das Verwaltungshandeln baut auf Gesetze, das hat bestimmte Formen – und das ist nicht die Pressekonferenz oder die Empfehlung“, so Gruber-Risak. Aus dieser Art der Kommunikation ergebe sich auch ein Dilemma: Wer unklare Botschaften sendet, riskiert, nicht mehr ernst genommen zu werden.

Die Unsicherheit bleibt
Auch durch Verordnungen, in denen immer wieder Fehler vorkamen, zog sich diese Unklarheit. Das wurde, wie vieles andere auch, zu Beginn der Krise entschuldigt. Doch die Situation verbesserte sich nicht, im Gegenteil. Im Juli wurde etwa eine Verordnung veröffentlicht, die 27 Fehler enthielt und inhaltlich widersprüchlich war. An eine Verbesserung der Qualität glaubt Gruber-Risak nicht. Über die letzten Monate hätte es genug Möglichkeiten zur Verbesserung gegeben, etwa durch stärkere Einbindung von Expert*innen. Doch passiert ist das nicht. „Wenn diese juristische Grauzone von der Pandemie übrigbleibt, wäre das ein extrem negativer Einfluss“, so der Experte.
Doch das Ende der Pandemie ist noch fern, und wir stehen vor dem möglichen Beginn einer zweiten Welle. Soeben wurde die aktuelle Novellierung von Epidemiegesetz und COVID-19-Gesetz veröffentlicht. Und auch diese wird ob vieler Unsicherheiten stark kritisiert. „Die kommunikative Misere wird hier weitergeführt“, sagt Burger. Business as usual also.