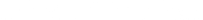Arbeit&Wirtschaft: Wie weit hat Sie das diesjährige Gedenkjahr beschäftigt bzw. betroffen?
Ferdinand Lacina: Wichtig war für mich erstens 100 Jahre Gründung der österreichischen Republik am 12. November. Zweitens das Jahr 1968 in der Tschechoslowakei, ein beeindruckender Versuch, einen Kommunismus mit menschlichem Antlitz zu schaffen – der dann ja unter den Panzern zermalmt wurde. Ich habe damals eine Reportage für die A&W über die Veränderungen in der Stahlindustrie gemacht.
Da war ich unter anderem in Košice, in der Slowakei und in den Stahlwerken in Mährisch-Ostrau. Die Eindrücke waren sehr unterschiedlich: In der Slowakei war alles sehr offen, in Mähren dagegen sehr stalinistisch geprägt. Dort hatten die alten Funktionäre auch zur Zeit Dubčeks noch sehr viel Macht.
In den Werken in Mährisch-Ostrau war neben jedem Arbeitsplatz eine Messlatte angebracht, wo für alle sichtbar die Produktivität und die Fehlzeiten jedes Arbeiters aufgelistet waren. Der dortige Belegschaftsvertreter hat mir erklärt, das diene dazu, den „sozialistischen Wettbewerb“ voranzutreiben. Die leistungsfähigsten Arbeiter bekamen dann Prämien, durften auf Urlaub fahren etc.
Wie haben Sie 1968 in Wien erlebt?
Das waren im Prinzip Ausläufer von dem, was in Deutschland oder Frankreich passierte. Man hat versucht, das hier nachzumachen. Das grenzte manchmal schon ans Absurde, etwa wenn vor dem Büro der Programmzeitschrift HörZu, dem einzigen hier ansässigen Medium der reaktionären Springer-Presse, demonstriert wurde. Ich habe damals zwar auch an der Demonstration teilgenommen, aber es war doch schwer zu vermitteln, denn die Fernseh-Illustrierte hatte nichts mit Politik zu tun.
Immerhin sind in Wien alle möglichen neuen Organisationen und Gruppen entstanden. Die meisten wurden von Frauen und Männern gegründet, die aus einem kommunistischen Elternhaus stammten. Im VSStÖ, der immer eher zum rechten Flügel der Partei gehört hatte, gewannen die „Linken“, zu denen auch ich gehörte, die Mehrheit.
Wie viele Menschen waren damals bei diesen Demos?
Ein paar hundert vielleicht, das waren keine Massendemos. Aber es hat sich danach doch einiges verändert, auch an den Universitäten. Fast bedeutender war eigentlich 1965 mit der Borodajkewycz-Affäre, die Heinz Fischer und ich ausgelöst hatten. Ich hatte noch während meiner Studienzeit die antisemitischen Aussagen bei den Vorlesungen mitgeschrieben. Was außerdem erwähnenswert ist: 1968 haben sich nicht nur linke Studenten, sondern auch die bürgerlichen radikalisiert.
1968 hat ja die ÖVP allein regiert …
Bruno Kreisky hat mit einem großen Team – er sprach immer von 1.400 Experten, ich habe nie nachgezählt – einen Gegenentwurf versucht. Ich war damals in der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der AK. Es wurden Reformprogramme ausgearbeitet, unter anderem in den Bereichen Justiz, Soziales, Bildung und Wirtschaft, die dann unter dem Motto „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“ präsentiert wurden. Es war das erste Mal, dass die SPÖ ein komplettes Wirtschaftsprogramm, nicht nur für die Verstaatlichte und die Infrastruktur, präsentierte. Die ÖVP hat die SPÖ ja nach wie vor als Schreckgespenst dargestellt, mittels der legendären roten Katze, die sich leise ins Haus schleicht und so unauffällig den Kommunismus mit sich bringt.
Was waren danach die wichtigsten Veränderungen?
Das Wirtschaftskonzept der ÖVP stammte von Stephan Koren, der 1968 Finanzminister wurde. Dieser Koren-Plan ist insofern erwähnenswert, weil es für die ÖVP eigenartig war, ihr Konzept einen „Plan“ zu nennen. Das klang ja geradezu nach der von ihr kritisierten Planwirtschaft. Koren versuchte damit, zur Modernisierung und Restrukturierung der österreichischen Wirtschaft beizutragen. Man wollte auch den Proporz abschaffen, daher waren etwa in dem neu gegründeten Entwicklungs- und Erneuerungsfonds nur Vertreter der Kammern, aber keine Parteienvertreter. Damals wurde also trotz ÖVP-Mehrheit versucht, den Dialog aufrechtzuerhalten, während heute die Arbeiterkammer fast überall hinausgedrängt wird. Ab 1970 mit der Regierung Kreisky wurde versucht, die günstige Konjunktur für Reformen und sozialpolitische Maßnahmen zu nutzen: Steuerreformen, Familienrechtsreform, Mutter-Kind-Pass usw. Nicht immer waren alle einverstanden – im Zuge der Diskussion um die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs in der Strafrechtsreform gab es viele Demonstrationen.
Die 70er waren eine sehr, sehr spannende Zeit. Kreiskys Ziel war die Durchflutung der Gesellschaft mit Demokratie. Später, besonders ab den 1990er-Jahren entstand international die Tendenz, die Gesellschaft mit dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, mit Kommerz zu durchfluten.
Und die 1980er-Jahre, wo Ihre politische Karriere begann?
Der Strukturwandel und die Energiekrise brachten Ende der 1970er-Jahre wesentliche Veränderungen in vielen Bereichen. Die Auswirkungen waren in Österreich durch die Sozialpartnerschaft und die paritätische Kommission nicht so gravierend, doch auch die verstaatlichte Grundstoffindustrie kam unter hohen Anpassungsdruck. Das war für die Sozialdemokratie, die stark mit der Verstaatlichten identifiziert wurde, eine große Herausforderung. Die Arbeitslosigkeit nahm zu.
Damals fiel auch das berühmte Kreisky-Zitat, dass ihm ein paar Milliarden Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten würden als ein paar hunderttausend Arbeitslose.
Ich wurde 1980 Kabinettschef von Bruno Kreisky und 1982 Staatssekretär. Um Arbeitsplätze zu erhalten, gab es mitunter konkrete Eingriffe – zum Teil gemeinsam mit dem Land Steiermark –, um Betriebe zu retten. Heute klingt das absurd, als Staat Unternehmen aufzukaufen, um diese und damit Arbeitsplätze zu retten. Überhaupt wäre das heute schwieriger, denn in den letzten Jahren ist in der EU etwas passiert, was eigentlich so nicht absehbar war.
Früher war die EU mehr oder weniger neutral gegenüber dem Eigentümer, in den letzten Jahren wurde es immer öfter als verbotener staatlicher Eingriff angesehen, wenn der Staat sich an einem Unternehmen beteiligt oder dessen Kapital erhöht.
Die Entwicklung ging ja dann in die andere Richtung, nämlich Richtung Privatisierung …
Ja, die Sache mit Intertrading, wo mit öffentlichen Mitteln spekuliert worden war, hat dann den entscheidenden Anstoß geliefert. Andererseits, die Verstaatlichung hatte seinerzeit ja zwei Ziele, nämlich die wichtigen Industrien dem Zugriff der Besatzungsmächte zu entziehen, insbesondere der sowjetischen, was im Übrigen ohnehin nicht gelungen ist. Der zweite Grund war, die Kommandohöhen der Wirtschaft zu neutralisieren. Spätestens in den 1980er-Jahren war beides nicht mehr aktuell. Die Verstaatlichte hat nicht mehr die Kommandohöhen der Industrie repräsentiert.
Was waren die wichtigsten Ereignisse während Ihrer Ministerzeit?
Als Verkehrs- und Verstaatlichtenminister: Wir haben mit regionalen Initiativen in den Industriegebieten versucht, den Strukturwandel der Wirtschaft möglichst glatt über die Bühne zu bringen. Wir wollten Zustände wie in der Wallonie, in England oder den Rust Belts der USA mit hoher Arbeitslosigkeit vermeiden. Natürlich konnte man nicht alles retten, aber mehr als man früher für möglich gehalten hätte. Die Obersteiermark etwa ist heute alles andere als ein Krisengebiet.
Wie ist das gelungen?
Durch verschiedenste Maßnahmen, zum Teil mit Forschungs- oder Investitionsförderungen, zum Teil hat man Partner hereingeholt. In der Nähe von Leoben und Graz sind Elektronikfabriken entstanden, für die das Know-how ausländischer Partner transferiert wurde.

Sie haben ja einige Reformen durchgeführt und sind deswegen 1992 als weltweit bester Finanzminister ausgezeichnet worden.
Wir haben im Wesentlichen zwei Dinge gemacht: eine durchgreifende Steuerreform, durch die das Steuersystem, vor allem die Einkommensteuer, wesentlich vereinfacht wurde. Die Negativsteuer wurde eingeführt, sodass auch jene, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen müssen, von der Reform profitieren konnten.
Wir haben die Lohnsteuerkarten und die Kfz-Steuermarken abgeschafft. Nicht zu vergessen die Unternehmenssteuerreform mit einer massiven Investitionsförderung, die unter Grasser abgeschafft wurde. Danach ist die Investitionskurve deutlich nach unten gegangen. Die Unternehmen sind dann stärker in die Finanzanlagen gegangen, von denen man damals mehr profitieren konnte als von produktiven Investitionen.
Das war ja einer der Gründe für die später überbordende Bedeutung der Finanzwirtschaft, die letztlich in die Krise geführt hat. Diese Vernachlässigung der Realwirtschaft wirkt bis heute nach.
Was hat Sie in dieser Zeit persönlich am meisten bewegt?
Erstens die Ostöffnung, wo wir versucht haben, österreichische Unternehmen zu unterstützen, damit sie sich dort niederlassen können. Und zweitens die Vorbereitungen zum EU-Beitritt, wo vieles erst möglich war durch die Veränderungen in der Sowjetunion unter Gorbatschow. Wir waren damals mit Bundeskanzler Vranitzky in Moskau und fanden ein ganz anderes Gesprächsklima vor als früher mit Andropov. Gorbatschow war sehr interessiert und hat viele Fragen gestellt, das war nicht nur ein Austausch von Phrasen. Und es war klar, dass die Sowjetunion gegen die Integration Österreichs in die Europäische Gemeinschaft keinen Widerstand leisten würde.
Ich nehme an, der Rücktritt als Finanzminister war ebenfalls ein denkwürdiges Ereignis?
1982 war Staatssekretär Nussbaumer im Amt verstorben und da Wahlen bevorstanden, hat Bruno Kreisky mich gefragt. Ich war ja seit 1980 sein Kabinettschef. Eigentlich habe ich damals mit ein paar Monaten in der Politik gerechnet, tatsächlich war das dann sehr viel länger. Prinzipiell bin ich sowieso der Meinung, dass jeder vor und nach einem politischen Amt auch etwas anderes machen sollte. Und ich habe immer vorgehabt, den Zeitpunkt meines Ausscheidens selbst zu bestimmen.
Das Bad in der Menge habe ich nie gebraucht und mir war klar, dass man die Wertschätzung des politischen Amtes mit persönlicher nicht verwechseln darf. So war mein Rücktritt keine große Geschichte. Wenn man längere Zeit in einem Amt ist und besonders als Finanzminister, dann muss man oft Nein sagen. Am Anfang wird das noch als Teil der Rolle akzeptiert, später nehmen das viele persönlich. Auch die Gewerkschaft war manchmal nicht zufrieden mit mir, insbesondere als der BAWAG riskante Geschäfte untersagt wurden.
Das ist wahrscheinlich sehr häufig so, dass die Menschen mit dem Finanzminister nicht sehr zufrieden sind, oder?
Vielleicht sind die Österreicher masochistisch – man ist eigentlich gar nicht so unbeliebt als Finanzminister. Ja, die ÖVP hat sich beschwert, dass ich mich in alles einmische. Natürlich muss man sich als Finanzminister in alles Mögliche einmischen und trifft auf Widerstand. So hat zum Beispiel Innenminister Blecha vor den Budgetverhandlungen in den Medien angeprangert, dass die Polizeihunde hungern müssten. Verteidigungsminister Lichal ist einmal mit 30 Offizieren bei mir aufmarschiert und hat sechs Milliarden Schilling mehr Budget für das Bundesheer verlangt – wobei das Bundesheer damals vergleichsweise mehr bekommen hat als heute.
Ein weiteres bedeutsames Jahr war 2008.
Europa hat auf die Krise zu spät und zu zögerlich reagiert. Im Fall Griechenland ist die europäische Solidarität verletzt worden. An der griechischen Krise haben letztendlich viele verdient: Banken, AnlegerInnen und Staatshaushalte der Euro-Länder. Griechenland ist in der Zwischenzeit verelendet. Heute ist Italien zwar hoch, aber vor allem im Inland verschuldet. Trotzdem möchte ich mir die wirtschaftlichen und politischen Folgen einer akuten Krise dieses Landes nicht ausmalen. Die alarmierendste Folge der Krise ist der Trend zu rechtspopulistischen Antworten auf Probleme – das reicht vom Brexit über Trump bis nach Italien. Und bei uns unterscheidet sich der Wahlverein Kurz, die ÖVP, kaum mehr von der FPÖ. Man muss schon einen guten Magen haben, um optimistisch zu sein.
Welche Lehren lassen sich aus der Krise ziehen?
Ideen zur Einschränkung der Finanzwirtschaft gibt es viele und bereits länger, etwa die Finanztransaktionssteuer oder auch die Aufteilung der Banken in jene, die Spareinlagen annehmen und Kredite vergeben und jene, die riskante Finanzgeschäfte tätigen. Für die Harmonisierung von Körperschaftsteuern in der EU sehe ich keine Chance, weil das einstimmig beschlossen werden müsste. Im Gegenteil, so sagt ja beispielsweise der irische Finanzminister, die 13 Milliarden, die Apple mir an Steuern hätte zahlen müssen, die will ich gar nicht. So machen Irland und andere Steueroasen Standortpolitik.

Österreich hat ja jetzt auch bald das Standort-Entwicklungsgesetz …
Die Regierung will eben unter allen Umständen eine Politik für die großen Unternehmen machen, deshalb werden Umweltorganisationen behindert. Sicher ist es sinnvoll, dass bei manchen Projekten Entscheidungen schneller fallen. Aber andererseits hängt die Zukunft Österreichs nicht davon ab, dass die dritte Piste des Flughafens Wien möglichst schnell gebaut wird. Ich selbst habe da auch einiges gelernt. Ich habe zum Beispiel damals der Elektrizitätswirtschaft wirklich geglaubt, dass es ohne Hainburg nicht geht, und davor hieß es, ohne Zwentendorf geht’s nicht. Und siehe da, es geht doch, ohne dass wir übermäßig viel Strom importieren müssen. Es ist einfach so, dass die Lobbys viel, ja zu viel Macht haben. Natürlich nicht nur in Österreich, sondern etwa auch in der EU sind ja wesentlich mehr Lobbyisten für Industrie und Wirtschaft als für Gewerkschaften oder NGOs tätig.
Was ist wichtig für die Zukunft Österreichs?
Fast 50 Prozent der Österreicherinnen sind teilzeitbeschäftigt, auch weil es zu wenig Kinderbetreuung gibt. In Deutschland droht Altersarmut, bei uns sind die Pensionen zwar höher, aber sie kann auch hier ein Problem werden. Ich kann mich erinnern, dass wir mit Johanna Dohnal den Bundesländern eine Kindergarten-Milliarde angeboten haben. Die haben geantwortet – übrigens nicht nur die ÖVP-dominierten Bundesländer –, dass sie das nicht brauchen. Das kommt selten vor, dass Länder Geld vom Bund ablehnen.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Bildung, die in Österreich noch immer vererbbar ist. Ich will nicht behaupten, dass die Ganztags- oder Gesamtschule die Allheilmittel sind, aber das wäre ein wichtiger Ansatz. Und eigentlich beginnt es ja schon im Kindergarten. Ich bin jetzt keineswegs dafür, dass dort schon das Leistungsprinzip herrschen soll. Aber eine Pädagogin für 20 bis 25 Kinder: Wie soll das gehen? Wir müssen sehr aufpassen, dass sich das Bildungssystem nicht genauso wie das Gesundheitssystem in zwei Klassen aufteilt.
Darf ich Sie zum Abschluss noch um einen Buchtipp bitten?
Der Falter-Chefredakteur Florian Klenk und Konrad Pesendorfer, Chef der Statistik Austria, haben ein Buch geschrieben: Zahlen, bitte! Interessanterweise hat Markus Marterbauer vor einigen Jahren ein Buch mit dem gleichen Titel veröffentlicht (Zahlen bitte! Die Kosten der Krise tragen wir alle, Deuticke 2011), das ich auch sehr empfehlen kann.
Astrid Fadler
Dieser Artikel erschien in der Ausgabe Arbeit&Wirtschaft 9/18.
Schreiben Sie Ihre Meinung an die Autorin
afadler@aon.at
oder die Redaktion
aw@oegb.at